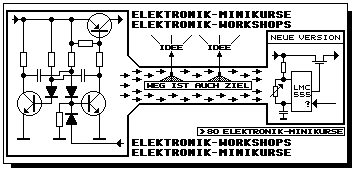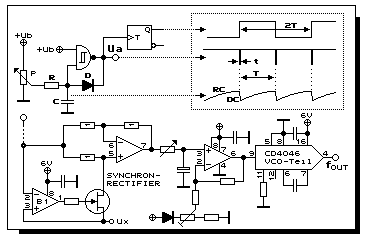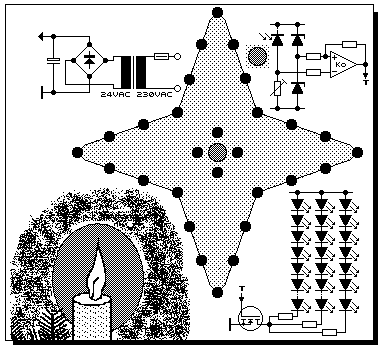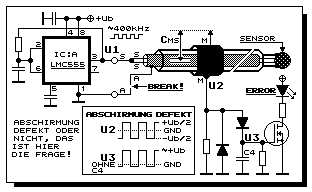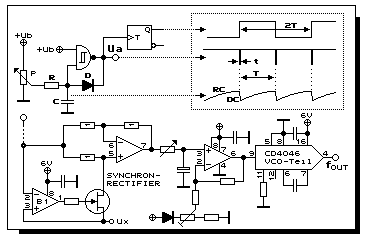
Überarbeitet wurde hauptsächlich der Teil bei dem selbst ein VCO mittels NAND-Gatter mit Schmitt-Trigger-Eigenschaft realisiert wird. Im Gegensatz zu vorher, ist dieser Inhalt wesentlich differenzierter beschrieben. Das vorher zugehörige Bild wurde in zwei Bildern erweitert, wodurch diese Inhalte ebenfalls wesentlich differenzierter sind. Es folgt die Einleitung zum gesamten erneuerten Elektronik-Minikurs:
Das Ziel ist es, zu verstehen, wie leicht man es sich machen kann, wenn es darum geht einen spannungsgesteuerten Oszillator (VCO) zu bauen, wenn einem ein passender Baustein – eine entsprechende Integrierte Schaltung (IC) – zur Verfügung steht. Es geht hier um die integrierte PLL-Schaltung (PLL = Phase Locked Loop) CD4046B bzw. MC14046B. Dieses IC enthält selbstverständlich auch einen VCO, und dieser kommt hier zur Anwendung. Es wird dabei eine praktische Anwendungsbrücke zu einem Teil eines meiner früheren Projekte geschlagen.
Da es aber nicht immer möglich ist, ein geeignetes IC für eine Anwendung zu finden, wird auf dem Weg zum Ziel gezeigt, wie man selbst einen VCO quasidiskret realisieren kann. Quasidiskret bedeutet, dass zwar auch ein einfaches IC benutzt wird, jedoch auch andere passive Bauteile eingesetzt werden müssen, bei denen genau verstanden werden muss, wozu sie im Einsatz sind. Eine solche VCO-Schaltung, die gezeigt und schrittweise erklärt wird, ist auch nur gerade eine von vielen Wegen, die nach Rom führen können. Es gilt in diesem Elektronik-Minikurs auch die Einschränkung, dass es um VCOs geht, die nur digitale Rechteckspannungen erzeugen.
Auf diesem Weg zum Ziel haben wir es dem Schmitt-Trigger zu tun. Es geht dabei einzig um die welche es in gewissen digitalen NAND-Gattern und Invertern gibt. Diese aktiven Teile sind der Kern des hier vorgestellten Rechteckgenerators, als Vorstufe zum VCO und den VCO selbst.
Beim Einsatz des VCO aus dem PLL-IC CD4046B (MC14046B) wird ein komplexeres analoges Umfeld mit einbezogen. Es geht um einen Teil der analogen Signalaufbereitung, der in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen kann. Es geht dabei um eine Signalverstärkung, um eine synchrone Gleichrichtung ohne Einsatz von Dioden, um die Erzeugung einer Referenzspannung weil nur eine positive Betriebsspannung und GND zum Einsatz kommt, und es zeigt, wie man mit einer Schaltung mit Operationsverstärkern (Opamps) den VCO-Bereich an die Pegelunterschiede des verstärkten Eingangssignales anpasst und gleichzeitig der DC-Pegel zum VCO so verschoben wird, dass die, für die analoge Schaltung notwendige Referenzspannung, wieder wegkompensiert wird, damit die VCO-Frequenz bis zu 0 Hz hinuntergefahren werden kann.
Da als Opamps sogenannte lineare CMOS-Opamps (LinCMOS-Opamp) zum Einsatz kommen, werden diese traditionsreichen und noch immer sehr beliebten Opamp-Familien von Texas-Instruments näher vorgestellt.
Ein ganz anderes Nebengeleise, das hier auch wiedermal etwas thematisiert wird, sind die sogenannten Block-Kondensatoren zwischen den Anschlüssen der Betriebsspannung und GND bei den ICs. Es wird thematisiert, wozu diese keramischen Multilayers denn unbedingt nötig sind.
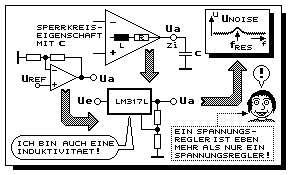 Auch wenn das Titelbild links den Eindruck erweckt, nein der Leser wird nicht über den Tisch gezogen. Es ist eine Frage der Betrachtung und eine Auseinandersetzung mit gewissen Details, dann stellt sich heraus, dass ein DC-Spannungsregler sich auch induktiv verhält.
Auch wenn das Titelbild links den Eindruck erweckt, nein der Leser wird nicht über den Tisch gezogen. Es ist eine Frage der Betrachtung und eine Auseinandersetzung mit gewissen Details, dann stellt sich heraus, dass ein DC-Spannungsregler sich auch induktiv verhält.
 Es wurden einige Kapitel leicht überarbeitet. Im Grunde ist es aber der selbe Inhalt wie bisher. Hinzu kommt im Kapitel DER DAMALIGE ZEITGEIST, HEUTE UND DIE MORAL die relativ neue Erkenntnis von Verhaltensforschern, dass neben Primaten und Menschen, auch die hochintelligenten Meeresbewohner Delphine ein Ich-Bewusstsein haben.
Es wurden einige Kapitel leicht überarbeitet. Im Grunde ist es aber der selbe Inhalt wie bisher. Hinzu kommt im Kapitel DER DAMALIGE ZEITGEIST, HEUTE UND DIE MORAL die relativ neue Erkenntnis von Verhaltensforschern, dass neben Primaten und Menschen, auch die hochintelligenten Meeresbewohner Delphine ein Ich-Bewusstsein haben. 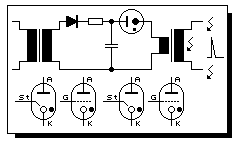 Diesen Teil des ELKO-Newsletters interessieren diejenigen unter den Lesern, welche Elektronik-Geschichte spannend finden. Es geht in diesem Elektronik-Minikurs um die Kaltkathodenröhre. Eigentlich Neues ist in diesem Update nicht hinzu gekommen, ausser in den Tiefen meiner ELKO-Directories ein längst vergessenes und eher zufällig wiederentdecktes File, das einen Leserbeitrag enthält. Asche auf mein Haupt, aber jetzt ist er endlich eingebaut. Es ist der zweite Leserbeitrag. Geschrieben wurde er damals von jemandem, der gestern, heute und morgen sehr fleissig nicht nur im ELKO-Forum mitwirkt(e). Ich denke, es wird nicht lange dauern und er wird sich melden… 🙂
Diesen Teil des ELKO-Newsletters interessieren diejenigen unter den Lesern, welche Elektronik-Geschichte spannend finden. Es geht in diesem Elektronik-Minikurs um die Kaltkathodenröhre. Eigentlich Neues ist in diesem Update nicht hinzu gekommen, ausser in den Tiefen meiner ELKO-Directories ein längst vergessenes und eher zufällig wiederentdecktes File, das einen Leserbeitrag enthält. Asche auf mein Haupt, aber jetzt ist er endlich eingebaut. Es ist der zweite Leserbeitrag. Geschrieben wurde er damals von jemandem, der gestern, heute und morgen sehr fleissig nicht nur im ELKO-Forum mitwirkt(e). Ich denke, es wird nicht lange dauern und er wird sich melden… 🙂