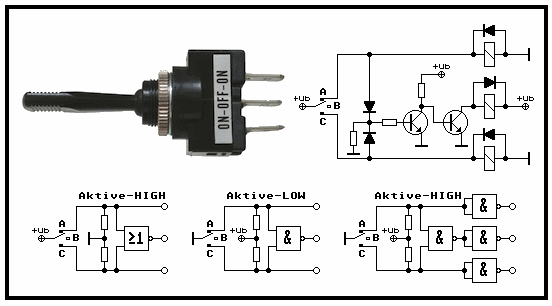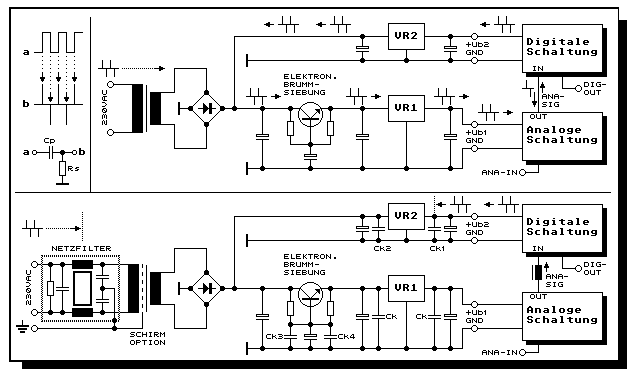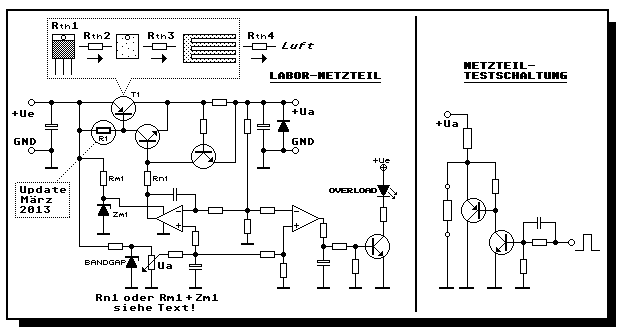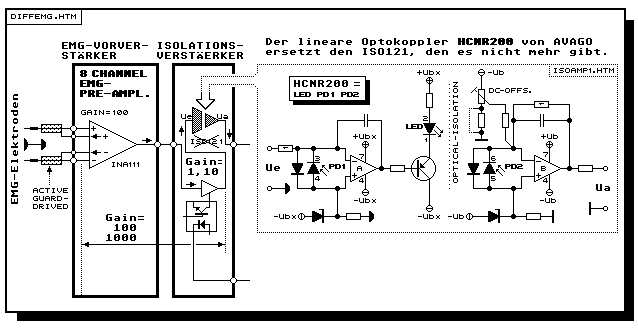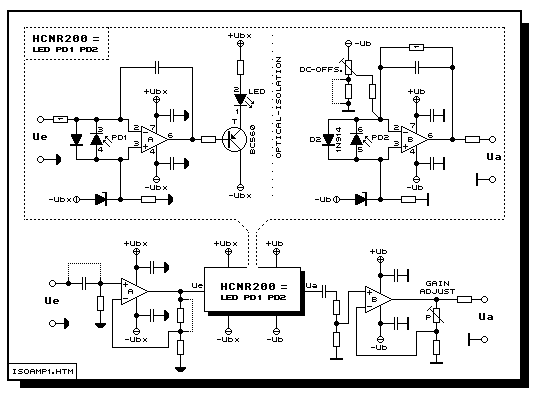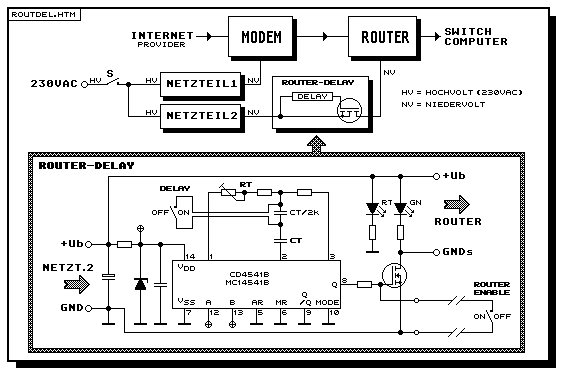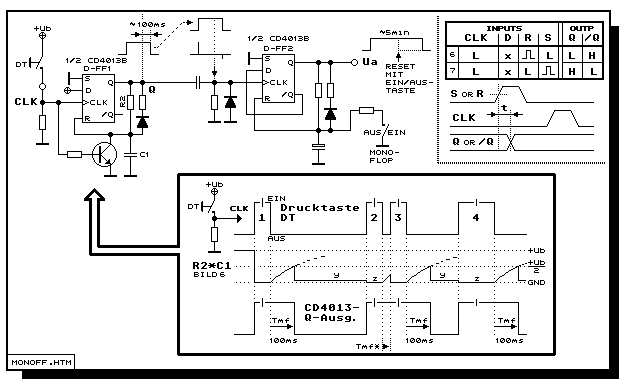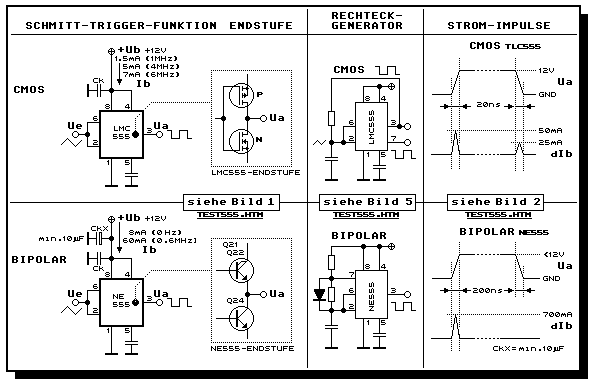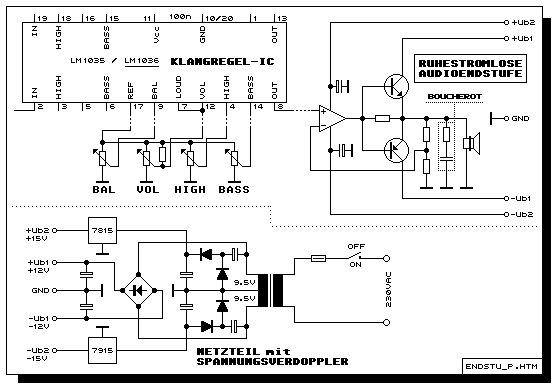Es ist nur möglich auf der Hauptseite des ELKO das begleitende Titelbild zum folgenden Text zu sehen. Damit dies im Newsletter auch möglich ist, öffne man im Web-Browser den folgenden Link:
/public/schaerer/bilder/k3u_tb1.gif
Wer kennt sie nicht, die kleinen Miniatur-Kippschalter. Es gibt solche die man direkt in eine Leiterplatte löten kann und andere eignen sich um in eine Frontplatte zu verschrauben. Es gibt verschiedene Ausführungsformen. Es gibt ein-, zwei- und mehrpolige. Es gibt Umschalter und Umtaster und es gibt sogar solche welche für den einen Kontakt eine Schalt- und für den andern eine Tastfunktion haben. Es gibt auch solche mit Verriegelungsmechanismen und es gibt Miniatur-Kippschalter mit Mittelstellung, wobei in dieser Stellung beide Kontakte offen sind. Ein solcher Schalter, mit der Eigenschaft ON-OFF-ON, zeigt dieses Foto (Newsletter: siehe oben Link). Solche Miniatur-Kippschalter benötigen wir in diesem Elektronik-Minikurs, weil es darum geht auf drei Leitungen je ein logisches HIGH- oder LOW-Signal zu erzeugen, um damit drei verschiedene Schaltfunktionen zu steuern. Damit ist es möglich mit einem ON-OFF-ON-Kippschalter drei unterschiedliche analoge Signalquellen zu wählen, wie wir noch sehen werden…
Es werden zuerst IC-Grundschaltungen mit den beiden Methoden Aktiv-HIGH und Aktiv-LOW vorgestellt. Danach folgt die Erweiterung mit Puffer. Dies hat den Vorteil, dass der Ausgangswiderstand unabhängig niederohmig ist vom logischen Pegel. Danach werden zwei Schaltungen ohne IC mit je zwei Dioden und einem Transistor vorgestellt. Vor allem der Bastler hat in seiner Bauteileschublade oft eine grosse Menge Kleinsignal-Transistoren und eher weniger Logik-ICs. Im nächsten Kapitel folgt die Umschaltung von drei digitalen Signalen mittels Tristate-Puffern und im folgenden Kapitel die Umschaltung von drei analogen Signalen mittels eines HCMOS-Analog-Schalter-IC. Dabei streifen wir auch kurz das Thema des LinCMOS-Opamp. Das Schlusskapitel widmet sich der Umschaltung von drei Relais. Eine integrierte und eine diskrete Version. Beides hat Vor- und Nachteile. Bei der IC-Version wird auch das Thema Überspannungsimpuls und Latchup mit einem Link zum passenden Elektronik-Minikurs erörtert.