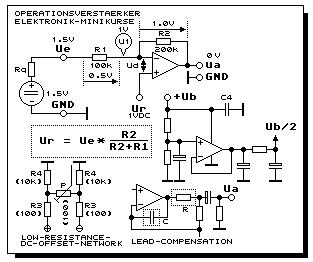
Ich möchte an dieser Stelle etwas auf die seit bereits vielen Jahren bestehenden Elektronik-Minikurse über Operationsverstärker aufmerksam machen. Dieses Thema ist fast unerschöpflich. Es gibt viel Literatur. In vielen liest man das selbe wenn es um die rudimentären Grundlagen geht. Tauchen die Inhalte in die Tiefe der Materie, unterscheiden sich die Inhalte darin, dass Unterschiedliches fokussiert wird. Oft hat dies auch damit zu tun, womit sich der Autor vorwiegend auseinandersetzt. Genau so steht es mit meinen Elektronik-Minikursen zum Themenkreis Operationsverstärker. Für diejenigen Leser des ELKO und des ELKO-Newsletter, welche meine workshopartigen Elektronik-Minikurse eher wenig kennen, möchte ich diese an dieser Stelle etwas zusammenfassen und damit vorstellen.
Elektronik-Minikurs OPERATIONSVERSTÄRKER I beschreibt die virtuelle Spannung und der virtuelle GND. Es wird erklärt wie sich die Spannung am vurtuellen Punkt (invertierender Eingang) verhält, wenn die Eingangsspannung schneller ändert als es die Geschwindigkeit des Opamp zulässt und warum es im quasi eingeschwungenen Zustand dazu führen muss, dass die Spannung zwischen dem invertierenden und nichtinvertierenden Eingang praktisch 0 V beträgt. Quasi eingeschwungen bedeutet, dass dieses Fast-Ideal dann zutrifft, wenn die Eingangsspannung stationär (DC-Spannung) oder eine AC-Spannung mit einer maximalen Frequenz ist, die wesentlich niedriger als die Frequenzbandbreite der Verstärkerschaltung ist. Diese Bandbreite ergibt sich aus der Unitiy-Gain-Bandbreite dividiert durch die Verstärkung, welche durch die Gegenkopplung bestimmt wird. Da die Anstiegsgeschwindigkeit (Slewrate) dabei auch eine wichtige Rolle spielt, ist auch dies thematisiert.
Ein weiteres Thema ist der Eingangswiderstand. Es gilt zu erkennen, warum dieser bei der invertierenden Verstärkerschaltung stets sehr viel niederohmiger ist als bei der nichtinvertierenden. Bei diesem Thema spielt die Betrachtung des virtuellen GND oder der virtuellen Spannung eine wichtige Rolle.
Ein weiteres Thema befasst sich mit wichtigen Erkenntnissen bei Opamp-Schaltungen mit einer einfachen Speisung (Single-Supply) und mit einer positiven und negativen Speisung (Dual-Supply). Es geht dabei darum, auf was man bei reinen AC- und DC-Verstärkerschaltungen achten muss und wie man bei Single-Supply eine stör- und rauscharme passive oder aktive Referenzspannung (Arbeitspunktspannung) erzeugt.
Eher als ein Nebenthema, aber kaum weniger wichtig, wird auf den Piezzo-Störeffekt hingewiesen, wenn in hochempfindlichen Verstärkerschaltungen an signalkritischen Stellen Kondensatoren zum Einsatz kommen, wobei man unbedingt auf Keramik- oder Multilayer-Kondensatoren verzichten sollte.
Link dazu:
Elektronik-Minikurs OPERATIONSVERSTÄRKER II thematisiert umfassend die DC-Offsetspannung und welche Methoden es gibt diese zu kompensieren. Dabei geht es um DC-Offsetspannungen die vom Oamp selbst und von der Signalquelle erzeugt werden. Es werden Methoden gezeigt wie man das Netzwerk zur abgleichbaren Kompensation der DC-Offsetspannung besonders niederohmig gestalten kann, was dann sehr wichtig ist, wenn diese Massnahme an der Beschaltung des invertierenden Einganges mit dem virtuelle GND (oder virtuellen Referenzspannung) vorgenommen werden muss. Auf dieses Thema wird differenziert eingegangen. Es folgt eine Schaltung für einen mehrkanaligen DC-Offsetspannungsabgleich mit hochpräzisen Bandgap-Spannungsreferenzen.
Die kapazitive Last am Ausgang einer Opamp-Verstärkerschaltung ist ebenfalls ein Thema. Es geht um die sogenannte Leed-Kompensation. In diesem Zusammenhang wird eine einfache Methode vorgestellt, wie man empirisch testen kann, ob die Verstärkerschaltung mit der nicht vermeidbaren Kapazität (langes Koaxialkabel) auch wirklich stabil arbeitet.
Link dazu:
Elektronik-Minikurs OPERATIONSVERSTÄRKER III ist relativ kurz. Er ergänzt weitgehend OPERATIONSVERSTÄRKER I und OPERATIONSVERSTÄRKER II. Es geht um die virtuelle Spannung vom Impedanzwandler bis zum Verstärker bei der invertierenden und nichtinvertierenden Verstärkerschaltung. Dabei wird der Leistungs-Opamp thematisiert. Es wird auch die Kompensation des Spannungsverlustes auf der Leitung vom Opamp zur Last fokussiert. Ein weiteres Thema ist das Einschwingverhalten bei steilflankigen Eingangsspannungen.
Link dazu:
Elektronik-Minikurs VOM OPERATIONSVERSTÄRKER BIS ZUM SCHMITT-TRIGGER, KONTINUIERLICH EINSTELLBAR. EINE DEMOSCHALTUNG! zeigt eine Schaltung die es ermöglicht mittels Einstellung eines Potmeters die Eigengschaften der Gegenkopplung (Verstärker), die Eigenschaften der Schaltung ohne Gegen- und Mitkopplung (Komparator) und die Eigenschaften mit Mitkopplung (Schmitt-Trigger) zu demonstrieren. Die Übergänge sind fliessend. Mit einem Trimmkondensator kann die Frequenzgangkompensation variiert werden. So kann man kritische Situationen zeigen, bei denen die Schaltung unerwünscht zu oszillieren beginnt. Diese Demoschaltung ist nachbaubar. Sie eignet sich hervorragend für Lehrkräfte welche Elektronikazubis unterrichten. Ich verwende sie in einem Praktikum.
Link dazu:


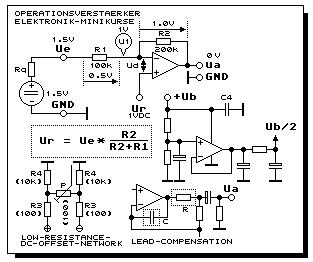
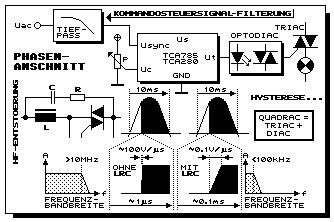
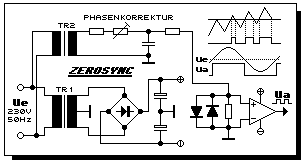
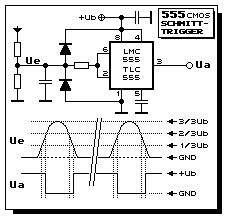

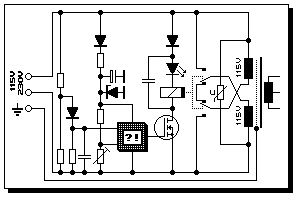
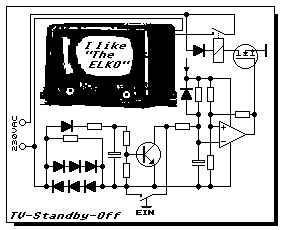
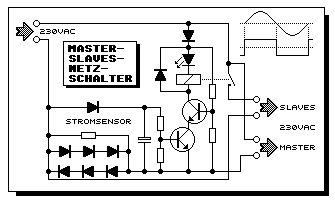 Man schaltet das Hauptgerät, den Master, ein oder aus und alle andern Geräte (Slaves) schalten sich ebenso ein oder aus. Eine kleine Schaltung macht’s möglich und dies ohne Eingriff in das Master-Gerät.
Man schaltet das Hauptgerät, den Master, ein oder aus und alle andern Geräte (Slaves) schalten sich ebenso ein oder aus. Eine kleine Schaltung macht’s möglich und dies ohne Eingriff in das Master-Gerät.