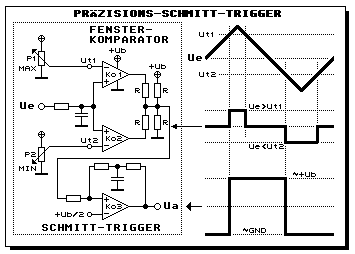
Ich stelle während einigen Jahren fest, dass u.a. im Forum des Elektronik-Kompendium immer wieder die selben Fragen betreffs Fensterkomparator und Präzisions-Schmitt-Trigger auftauchen. Ich antworte meist mit einem Hinweis auf die interne Schaltung des 555-Timer-IC. Ich erwähne dabei stets die CMOS-Version LMC555 und TLC555, weil die alte bipolare Version, z.B. NE555, überholt ist. Ich verweise auf einen ganz speziellen Elektronik-Minikurs zum Thema 555-Timer-IC und 230-VAC-Netzspannungs-Synchronisation. In dieser Schaltung dient der Fensterkomparator und das RS-Flipflop des LMC555 oder TL555 als Schmitt-Trigger. Ich weise zusätzlich darauf hin, dass man diese IC-interne Schaltung als Vorlage für einen eigenen Entwurf nutzen soll. Diese ständigen Wiederholungen solcher Fragen und Antworten motivierten mich diesen Elektronik-Minikurs zu schreiben und dabei erst noch zu zeigen, dass mit der Verwendung eines Quad-Opamp (Operationsverstärker = Opamp) oder Quad-Komparator (schnellere Anwendung) kein zusätzliches RS-Flipflop, benötigt wird. Man benötigt für den Präzisions-Schmitt-Trigger also nur gerade ein einziges IC.
Hier geht es um langsame Anwendungen, wie das Erfassen von quasistationären Signalen. Es sind elektrische Spannungungen, die z.B. von Temperatur-, Druck-, Feuchtigkeit- und andern physikalischen Sensoren erzeugt werden. Die Steuerungs- bzw. Regelmechanismen sind daher ebenfalls langsamer Natur. Deshalb kommen hier preiswerte Opamps und keine Komparatoren zum Einsatz. Favorit ist hier der tradionsreiche und berühmte Vierfach-Opamp LM324 von National-Semiconductor, von dem es aber auch einen kleineren Bruder, den LM358 mit nur zwei integrierten Opamps, gibt. Beide ICs sind elektrisch pro Opamp identisch. Diese beiden ICs sind auch sehr unproblematisch um mit den hier gezeigten Schaltungen zu experimentieren, unproblematisch z.B. bezüglich Schwingneigung. Ich hoffe, dass dieser Elektronik-Minikurs viele Fragen zu diesem Thema beantworten wird und den einen oder andern dazu anregt mit den Schaltungen zu experimentieren.

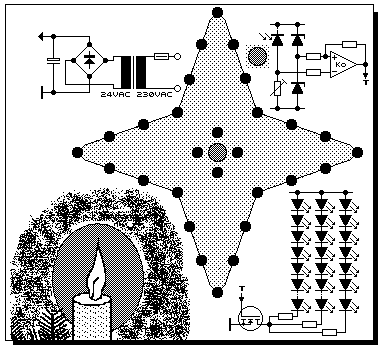
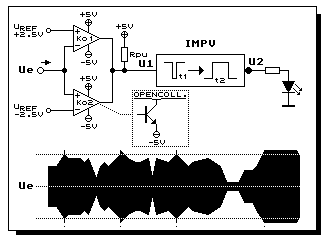
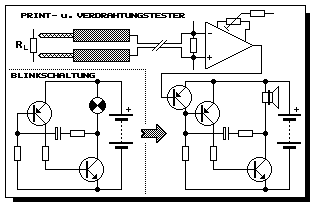
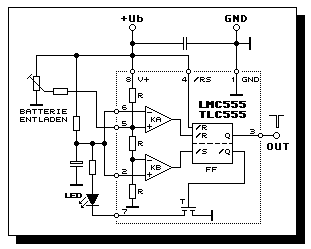
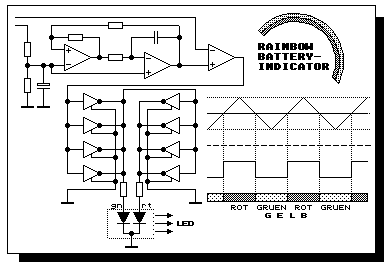 Es ist ein elektronischer Indikator, der den Ladezustand einer Batterie prüft, wobei dieser Indikator Teil eines Gerätes sein kann und selbst nur eine nebensächliche aber trotzdem wichtige Funktion erfüllt. Diese Schaltung kann auch an einen Blei-Akku angepasst werden.
Es ist ein elektronischer Indikator, der den Ladezustand einer Batterie prüft, wobei dieser Indikator Teil eines Gerätes sein kann und selbst nur eine nebensächliche aber trotzdem wichtige Funktion erfüllt. Diese Schaltung kann auch an einen Blei-Akku angepasst werden.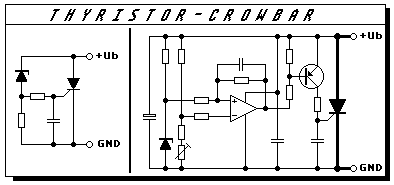
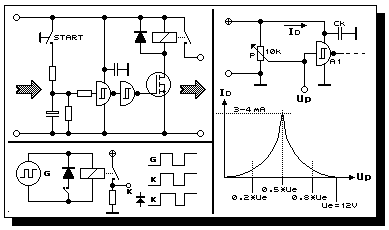
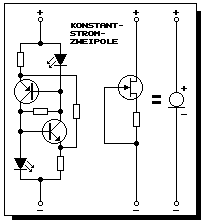 Der Inhalt dieses Elektronik-Minikurses wurde erweitert und gewisse Teile davon differenzierter beschrieben. Ein Konstantstromzweipol hat, wie die Bezeichnung sagt, nur zwei Pole. Er eignet sich also dann, wenn nur zwei Anschlüsse zur Verfügung stehen, – z.B. als Ersatz für einen Widerstand, weil ein konstanter Strom gefordert ist.
Der Inhalt dieses Elektronik-Minikurses wurde erweitert und gewisse Teile davon differenzierter beschrieben. Ein Konstantstromzweipol hat, wie die Bezeichnung sagt, nur zwei Pole. Er eignet sich also dann, wenn nur zwei Anschlüsse zur Verfügung stehen, – z.B. als Ersatz für einen Widerstand, weil ein konstanter Strom gefordert ist.