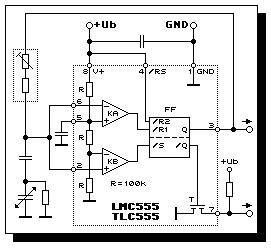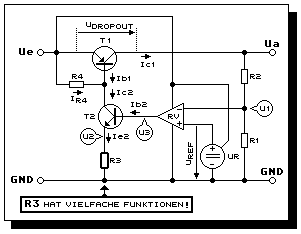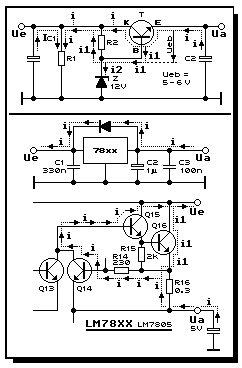 Dieser Elektronik-Minikurs ist massiv überarbeitet und erweitert. Neu ist das Kapitel „WARUM IST DER RÜCKSTROM SCHÄDLICH?“. Es zeigt am Beispiel einer sehr einfachen diskreten Schaltung zur Stabilisierung von einer Gleichspannung und am Beispiel eines Teils des Innenlebens des traditionsreichen 5V-Fixspannungsreglers LM7805, warum und wie die Ströme vom Ausgang Ua in Richtung des Einganges Ue zurückfliessen, wenn keine Rückfluss-Diode als Schutz zum Einsatz kommt. In Text und Bild wird erklärt, warum dieser Rückstrom für den Spannungsregler gefährlich werden kann und ihn, mit dramatischen Folgen für die gespeiste Schaltung, zerstört.
Dieser Elektronik-Minikurs ist massiv überarbeitet und erweitert. Neu ist das Kapitel „WARUM IST DER RÜCKSTROM SCHÄDLICH?“. Es zeigt am Beispiel einer sehr einfachen diskreten Schaltung zur Stabilisierung von einer Gleichspannung und am Beispiel eines Teils des Innenlebens des traditionsreichen 5V-Fixspannungsreglers LM7805, warum und wie die Ströme vom Ausgang Ua in Richtung des Einganges Ue zurückfliessen, wenn keine Rückfluss-Diode als Schutz zum Einsatz kommt. In Text und Bild wird erklärt, warum dieser Rückstrom für den Spannungsregler gefährlich werden kann und ihn, mit dramatischen Folgen für die gespeiste Schaltung, zerstört.
Ebenfalls neu ist das Kapitel „ZUSÄTZLICHER SPANNUNGSREGLER MIT VORWIDERSTAND?“. Gemeint ist, man hat z.B. ein Netzteil mit einer Ausgangsspannung von ±15 VDC und einem maximalen Strom von 1 A. Realisierbar ist so etwas ganz leicht mit einem LM317 und LM337 mit dem notwendigen passiven „Zugemüse“, wie Netztrafo, Brückengleichrichter, Widerstände und Kondensatoren. Dazu kommt, dass man für irgend eine kleine digitale Schaltung noch eine Spannung von +5 VDC und einen Strom von 50 mA benötigt. Dieser Teil des Minikurs ist eine Art Diskussion darüber, ob es Sinn macht den kleinen Bruder des 7805, den 78L05 ohne oder mit einem Vorwiderstand einzusetzen. Oder läuft es, wenn man über alle möglichen Zustände nachdenkt, die diese Zusatzschaltung einnehmen kann, vielleicht darauf hinaus, dass es keine gute Lösung ist und man besser dran ist, gleich einen 7805, also nicht den kleinen Bruder, für diesen Zweck einzusetzen. Es wird auch noch ganz kurz eine Lösung vorgestellt, wann es Sinn macht, den modernen 7805-Schaltregler von RECOM einzusetzen. Ein Schaltregler, der wie der Original-7805, ebenfalls als ein Dreibeiner in einem Gehäuse steckt, das fast die selben Abmessungen hat wie der TO220 und keine zusätzlichen Bauteile benötigt, wie es sonst für Schaltregler üblich ist. Dieses Kapitel habe ich geschrieben, weil zu diesem Thema im ELKO-Forum schon oft diskutiert wurde.
Zum Schluss noch kurz eine Zusammenfassung woraus dieser Elektronik-Minikurs sonst noch besteht. Wie schon der Titel sagt, thematisiert werden dreibeinige Spannungsregler mit fixen und variablen Augangsspannungen. Es geht um das richtige Abblocken der Ein- und Ausgänge mit Kondensatoren. Warum sollte man dafür keine Tantalelkos einsetzen! Diese Spannungsregler haben einen minimalen niedrigen Laststrom, ohne den sie nicht richtig arbeiten. Der maximale Ausgangsstrom und der interne Schutz vor Überlast unter der Berücksichtigung des sichereren Betriebszustandes (Safe Operating Area). LM317 und LM337: Die Berechnung des Widerstandsnetzwerkes ist praxisorientiert einfacher, als es im Datenblatt angegeben ist und warum dies auch wirklich zutrifft. Wie beim LM317 und LM337 ein zusätzlicher Kondensator dafür sorgt, dass die Restrippelspannung am Ausgang um 20 dB niedriger ist als ohne. Der LM317 als Konstantstromquelle und worauf es dabei im Detail ankommt. All dies und noch mehr, erfährt man in diesem Elektronik-Minikurs:
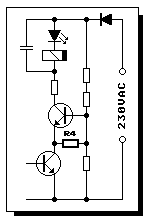 Im letzten Update vom 09.03.2010 habe ich von den Tücken einer Transistorkaskade geschrieben, so wie sie Teil in diesem Elektronik-Minikurs ist. Es ging darum, dass bei zu schnellem Ausschaltvorgang der eine der beiden Transistoren, während etwa 0.1 ms, eine gefährliche Überspannung erhalten kann. Die einfache Abhilfe besteht darin, die Steilheit der Schaltflanken mittels passivem RC-Tiefpassfilter leicht zu reduzieren.
Im letzten Update vom 09.03.2010 habe ich von den Tücken einer Transistorkaskade geschrieben, so wie sie Teil in diesem Elektronik-Minikurs ist. Es ging darum, dass bei zu schnellem Ausschaltvorgang der eine der beiden Transistoren, während etwa 0.1 ms, eine gefährliche Überspannung erhalten kann. Die einfache Abhilfe besteht darin, die Steilheit der Schaltflanken mittels passivem RC-Tiefpassfilter leicht zu reduzieren.
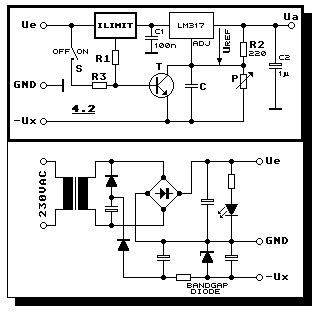 Der Titel erklärt bereits worum es geht. Es geht darum den allseits sehr beliebten und traditionsreichen Spannungsregler LM317 universeller einzusetzen. Über eine solche Absicht wurde schon oft im Forum des Elektronik-Kompendium diskutiert. Der LM317 hat natürlich Konkurrenz, wenn man mehr aus ihm machen will.
Der Titel erklärt bereits worum es geht. Es geht darum den allseits sehr beliebten und traditionsreichen Spannungsregler LM317 universeller einzusetzen. Über eine solche Absicht wurde schon oft im Forum des Elektronik-Kompendium diskutiert. Der LM317 hat natürlich Konkurrenz, wenn man mehr aus ihm machen will. 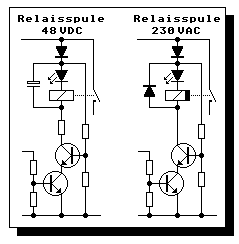
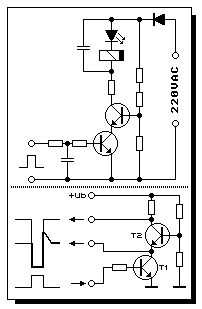 Wenn keine geeigneten bipolaren Transistoren für kleine Kollektorströme und für hohe Spannungen zur Verfügung stehen, kann man vielleicht MOSFETs einsetzen. Vielleicht, weil das ist, je nach Schaltung, nicht immer möglich. Dies z.B. dann, wenn die Steuerquelle nur eine sehr kleine Spannung zur Verfügung stellt, die nicht ausreicht für eine ausreichende Gate-Source-Spannung. Wenn diese Spannung jedoch wenigstens etwas grösser ist, als die Basis-Emitter-Schwellenspannung eines bipolaren Transistors und die Quelle genügend Basistrom für einen solchen Transistor liefern kann, dann besteht die Möglichkeit zwei bipolare Transistoren zu kaskadieren, um die zu hohe Kollektor-Emitter-Spannung auf zwei Transistoren zu verteilen. Es sind grundsätzlich auch mehr als zwei Transistoren kaskadierbar. Allerdings hat diese Kaskadierung auch ihre Tücken und genau dies ist das erweiterte Thema im vorliegenden Elektronik-Minikurs in einem neuen Kapitel.
Wenn keine geeigneten bipolaren Transistoren für kleine Kollektorströme und für hohe Spannungen zur Verfügung stehen, kann man vielleicht MOSFETs einsetzen. Vielleicht, weil das ist, je nach Schaltung, nicht immer möglich. Dies z.B. dann, wenn die Steuerquelle nur eine sehr kleine Spannung zur Verfügung stellt, die nicht ausreicht für eine ausreichende Gate-Source-Spannung. Wenn diese Spannung jedoch wenigstens etwas grösser ist, als die Basis-Emitter-Schwellenspannung eines bipolaren Transistors und die Quelle genügend Basistrom für einen solchen Transistor liefern kann, dann besteht die Möglichkeit zwei bipolare Transistoren zu kaskadieren, um die zu hohe Kollektor-Emitter-Spannung auf zwei Transistoren zu verteilen. Es sind grundsätzlich auch mehr als zwei Transistoren kaskadierbar. Allerdings hat diese Kaskadierung auch ihre Tücken und genau dies ist das erweiterte Thema im vorliegenden Elektronik-Minikurs in einem neuen Kapitel.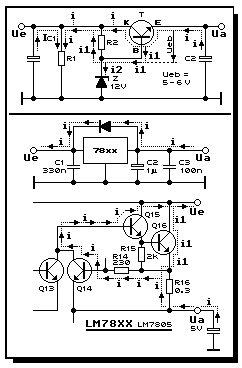 Dieser Elektronik-Minikurs ist massiv überarbeitet und erweitert. Neu ist das Kapitel „WARUM IST DER RÜCKSTROM SCHÄDLICH?“. Es zeigt am Beispiel einer sehr einfachen diskreten Schaltung zur Stabilisierung von einer Gleichspannung und am Beispiel eines Teils des Innenlebens des traditionsreichen 5V-Fixspannungsreglers LM7805, warum und wie die Ströme vom Ausgang Ua in Richtung des Einganges Ue zurückfliessen, wenn keine Rückfluss-Diode als Schutz zum Einsatz kommt. In Text und Bild wird erklärt, warum dieser Rückstrom für den Spannungsregler gefährlich werden kann und ihn, mit dramatischen Folgen für die gespeiste Schaltung, zerstört.
Dieser Elektronik-Minikurs ist massiv überarbeitet und erweitert. Neu ist das Kapitel „WARUM IST DER RÜCKSTROM SCHÄDLICH?“. Es zeigt am Beispiel einer sehr einfachen diskreten Schaltung zur Stabilisierung von einer Gleichspannung und am Beispiel eines Teils des Innenlebens des traditionsreichen 5V-Fixspannungsreglers LM7805, warum und wie die Ströme vom Ausgang Ua in Richtung des Einganges Ue zurückfliessen, wenn keine Rückfluss-Diode als Schutz zum Einsatz kommt. In Text und Bild wird erklärt, warum dieser Rückstrom für den Spannungsregler gefährlich werden kann und ihn, mit dramatischen Folgen für die gespeiste Schaltung, zerstört.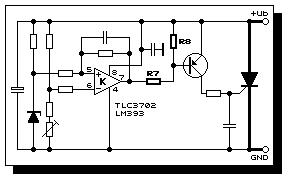 Die Aufgabe eines Thyristor-Crowbar besteht darin, eine dauerhafte Überspannung, welche z.B. durch den Defekt eines Netzteiles zustande kommt, mittels brachialer Gewalt, sofort zu eliminieren. Dazu verwendet man eine passende Sensorschaltung, welche die Überspannung misst und einen Thyristor auslöst, der zwischen Anode und Kathode die Betriebsspannung kurzschliesst. Damit wird entweder eine Schmelzsicherung ausgelöst oder eine sogenannte Foldback-Strombegrenzung reduziert den Strom durch den Thyristor derart, dass keine nennenswerte Verlustleistung und Erwärmung erzeugt wird.
Die Aufgabe eines Thyristor-Crowbar besteht darin, eine dauerhafte Überspannung, welche z.B. durch den Defekt eines Netzteiles zustande kommt, mittels brachialer Gewalt, sofort zu eliminieren. Dazu verwendet man eine passende Sensorschaltung, welche die Überspannung misst und einen Thyristor auslöst, der zwischen Anode und Kathode die Betriebsspannung kurzschliesst. Damit wird entweder eine Schmelzsicherung ausgelöst oder eine sogenannte Foldback-Strombegrenzung reduziert den Strom durch den Thyristor derart, dass keine nennenswerte Verlustleistung und Erwärmung erzeugt wird.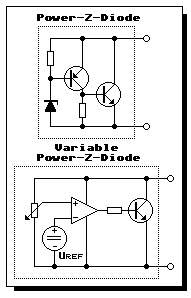
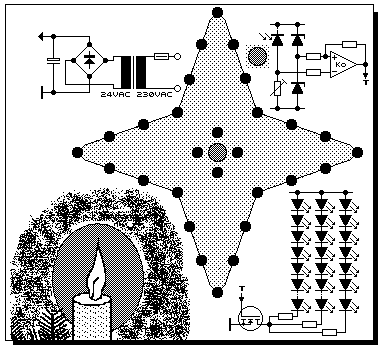 Im letzten ELKO-Newsletter war zu lesen: Alle Jahre wieder sind wir auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken. Doch bevor kurz vor Weihnachten die allgemeine Hektik ausbricht, lohnt es sich jetzt schon ein paar Gedanken zu machen. Leider haben alle Leute schon alles. Deshalb ist es schwer ein passendes Geschenk zu finden. Doch Schenken macht gerade dann am meisten Spass, wenn der Beschenkte etwas bekommt, was er nicht dringend braucht.
Im letzten ELKO-Newsletter war zu lesen: Alle Jahre wieder sind wir auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken. Doch bevor kurz vor Weihnachten die allgemeine Hektik ausbricht, lohnt es sich jetzt schon ein paar Gedanken zu machen. Leider haben alle Leute schon alles. Deshalb ist es schwer ein passendes Geschenk zu finden. Doch Schenken macht gerade dann am meisten Spass, wenn der Beschenkte etwas bekommt, was er nicht dringend braucht.