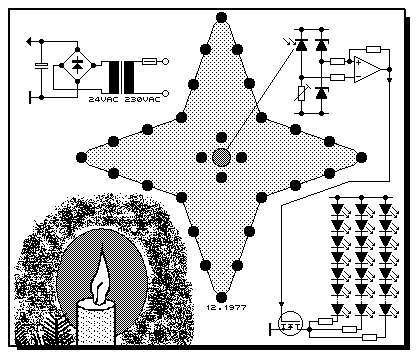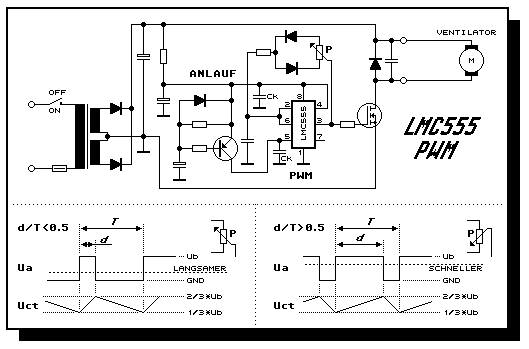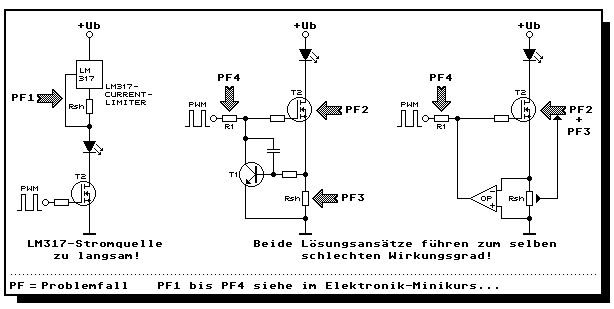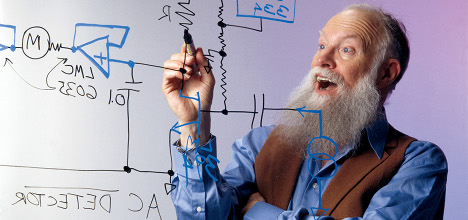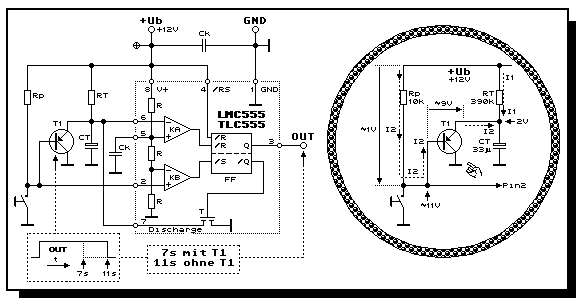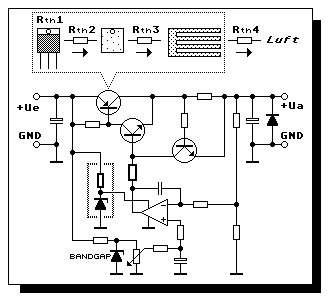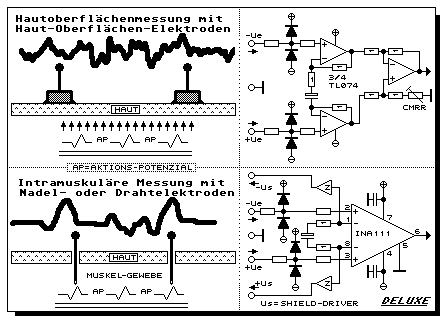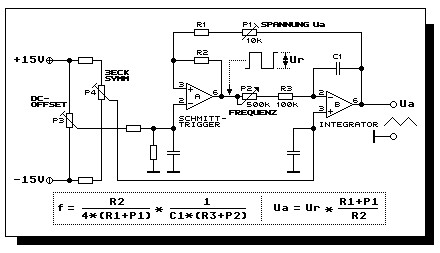Im ELKO-Newsletter vom 02.11.2011 war in der Einleitung zu lesen:
„Alle Jahre wieder sind wir auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken. Doch bevor kurz vor Weihnachten die allgemeine Hektik ausbricht, lohnt es sich jetzt schon ein paar Gedanken zu machen. Leider haben alle Leute schon alles. Deshalb ist es schwer ein passendes Geschenk zu finden. Doch Schenken macht gerade dann am meisten Spass, wenn der Beschenkte etwas bekommt, was er nicht dringend braucht.“
Beim Schenken gibt es anstelle von Kaufen auch die Möglichkeit etwas selbst zu basteln. Geeignet für die dunkeln Winterabende. Wem dabei nichts in den Sinn kommt, empfehle ich diesen elektronischen Weihnachtsstern:
Es waren die letzten Monate des Jahres 1977 als ich einen solchen Weihnacht-LED-Stern baute und am 17. Dezember 1977 war er mit einer Spannweite von etwa 50 cm fertig. Von damals bis heute strahlt er jeden letzten Monat im Jahr aus dem Fenster in meine Wohngegend und trägt seinen Teil zur vorweihnachtlichen Stimmung bei. Wenn es zur Abendstunde dämmert und die vielen elektrischen Kerzen die Wohnzimmerfenster schmücken, schaltet sich mein rot leuchtender LED-Stern mit seinen 36 Leuchtdioden ein, leuchtet bis zur Morgendämmerung und schaltet sich wieder automatisch aus. 32 dieser LEDs sind auf die vier Sternzacken verteilt und vier weitere sind um das Zentrum des Sterns angeordnet. Im Zentrum befindet sich die mattierte runde Plexiglasscheibe die das Umgebungslicht für die Fotodiode einfängt und dessen nachfolgende Elektronik bei der Abenddämmerung die LEDs ein- und bei der Morgendämmerung wieder ausschaltet. Der Stern besteht aus einem dünnen und leichten Sperrholzbrett und in der Mitte auf der Hinterseite befindet sich das Kästchen mit der Dämmerungselektronik. Es gibt auch eine modernere Version der ursprünglichen Schaltung, u.a. mit MOSFET anstelle einer Darlingtonstufe, zur Steuerung der LEDs. Dieser Elektronik-Minikurs kann auch eine Anregung dafür sein, eigene Ideen zu entwickeln…
Viel Spass beim Basteln,
Euer ELKO-Thomas