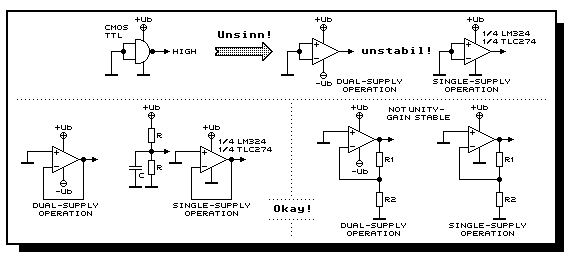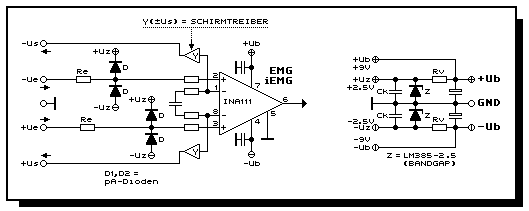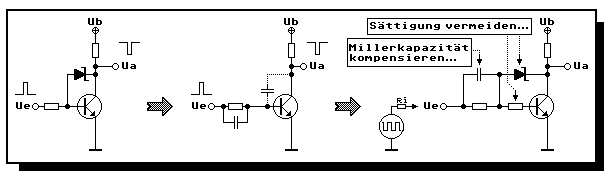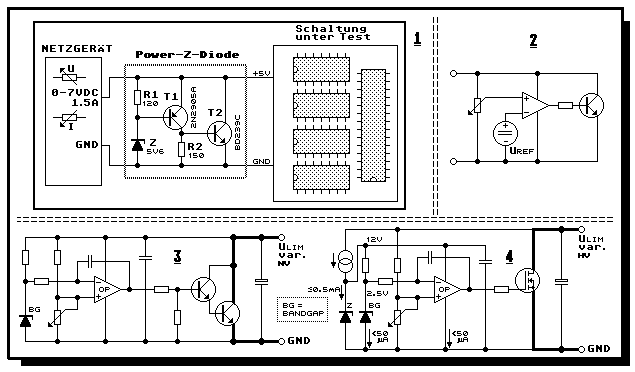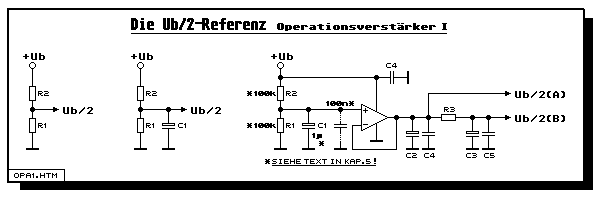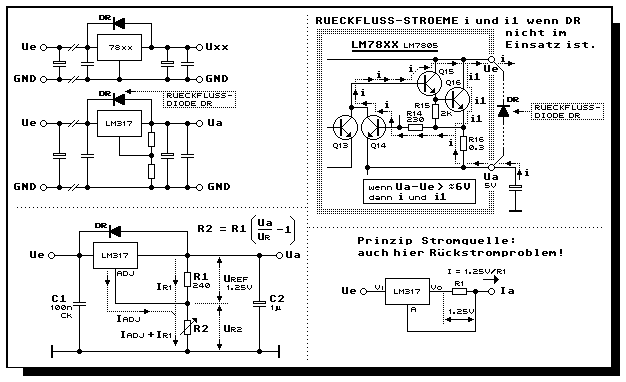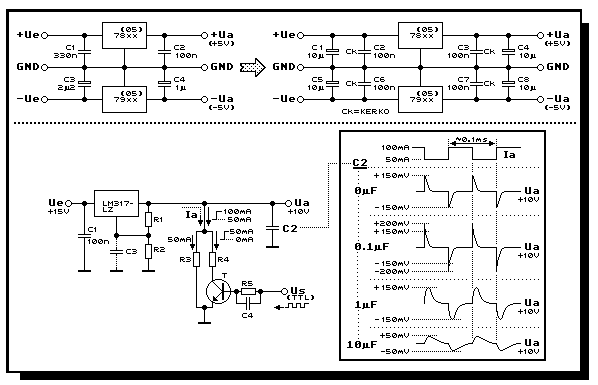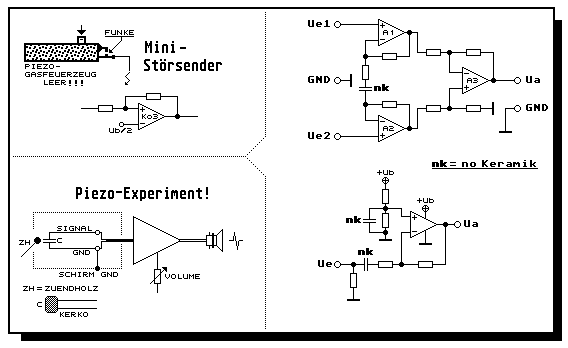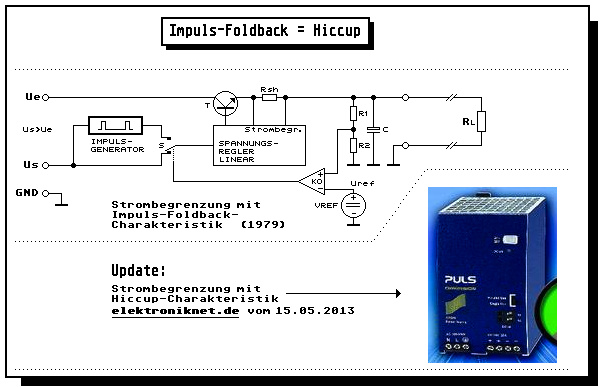Es ist nur möglich auf der Hauptseite des ELKO das begleitende Titelbild zum folgenden Text zu sehen. Damit dies im Newsletter auch möglich ist, öffne man im Web-Browser den folgenden Link:
/public/schaerer/bilder/opa1_t4.gif
Dieses Update betrifft die beiden neuen Kapitel DER UNBENUTZTE OPAMP UND DIE RICHTIGE BESCHALTUNG und WENN OPAMPS ANDERE OPAMPS STÖREN.
Es kommt bei einem Vierfach-Opamp (Quad-Opamp) immer wieder mal vor, dass man in einer Schaltung nur drei dieser vier Opamps benötigt und da stellt sich die Frage, wie man den unbenutzten Opamp richtig beschaltet.
Im erstgenannten Kapitel (siehe Titelbild) zeigt das Teilbild oben, wie eine völlig falsche Idee entstehen und sich etablieren kann. Es ist genau beschrieben, warum dies unsinnig ist. Das untere Teilbild zeigt, wie man es richtig macht. Die Erklärung umfasst die Single-Supply- (+Ub) und die Dual-Supply-Speisung (±Ub). Berücksichtigt werden dabei „normale“ Opamps und solche mit Single-Supply-Eigenschaften, was nicht exakt das selbe ist wie Opamps mit Rail-to-Rail-Eigenschaften. Dazu kommt noch, was muss man tun, wenn der Opamp nicht unity-gain-stable ist.
Das zweitgenannte Kapitel: In einem Quad- oder auch Dual-Opamp kann man nicht alle Schaltfunktionen gemeinsam integrieren die man gerne haben möchte. So ist es z.B. nicht empfehlenswert eine empfindliche Verstärkerschaltung und ein Rechteckgenerator gemeinsam in einem IC unterzubringen, weil steile Flanken und hohe Amplituden die analoge Schaltung empfindlich stören können. So können leicht Opamps übrig bleiben, die man nicht einsetzen kann und da kommt das erstgenannte Kapitel zum Einsatz.
Gruss Euer
ELKO-Thomas