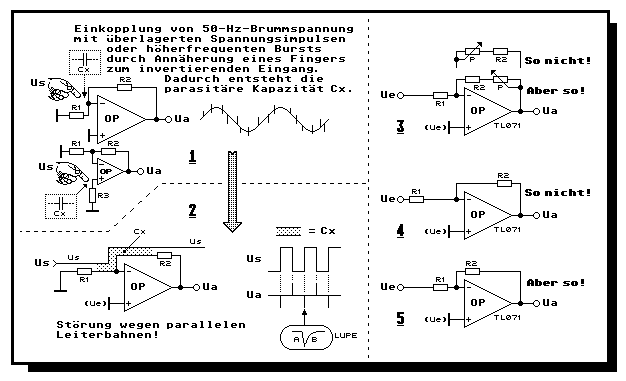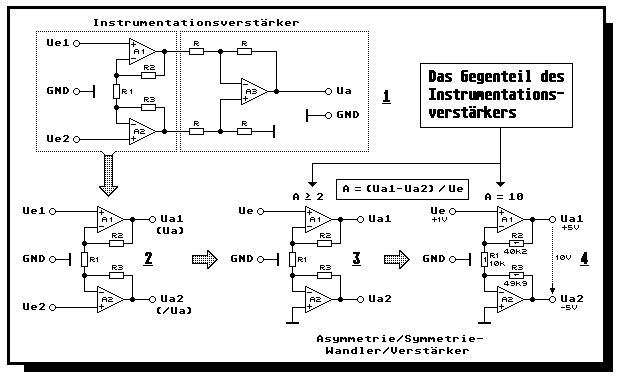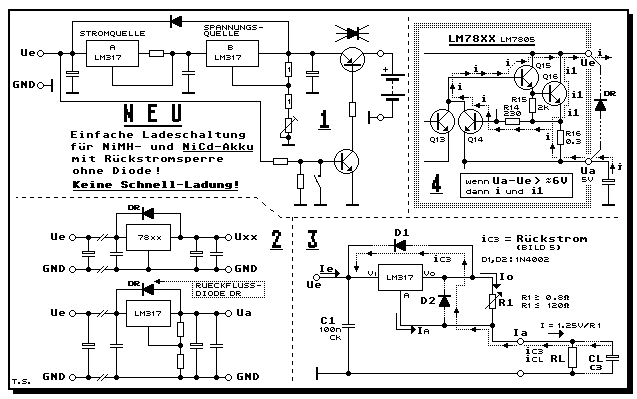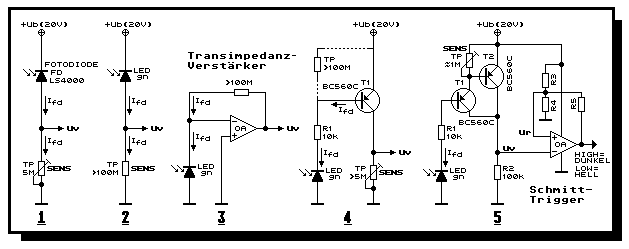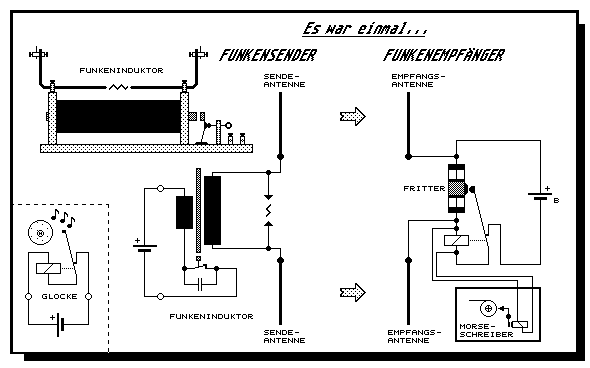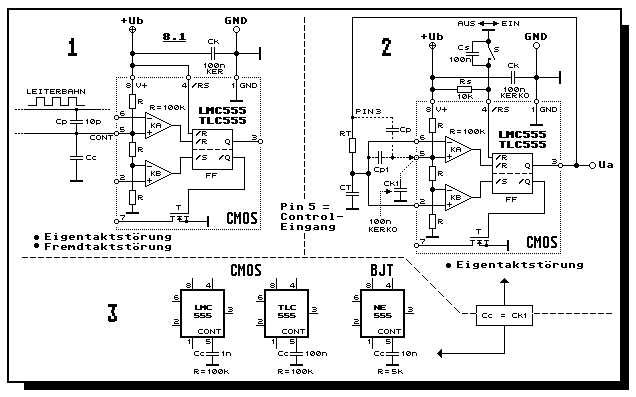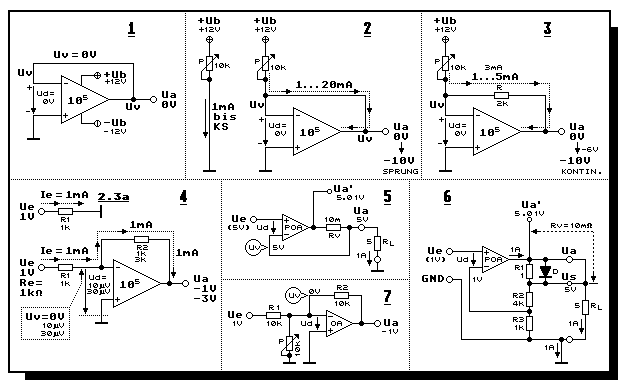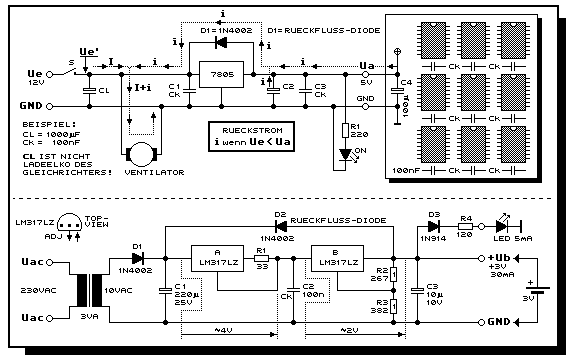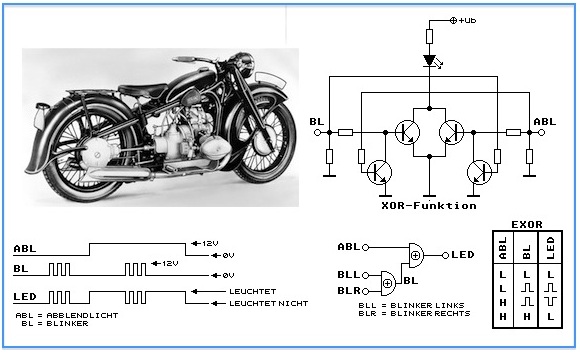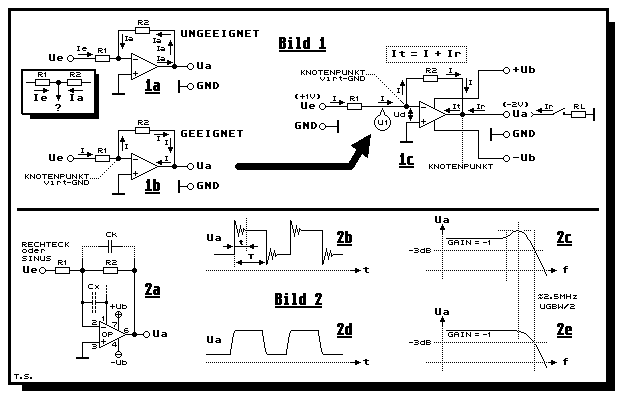Dieser neue vierte Elektronik-Minikurs zum Thema Operationsverstärker (Opamp) befasst sich mit unterschiedlichen Störproblemen bei Opamp-Schaltungen. Es beginnt mit der störarmen Beschaltung. Es gilt der elementare Grundsatz, dass eine analoge signalverstärkende oder signalverarbeitende Schaltung so niederohmig wie möglich realisiert sein sollte. Dies reduziert das Risiko der parasitär-kapazitiven Einkopplung von elektrischen Wechselfeldern. Eine solche Störquelle ist oft in unmittelbarer Nähe, nämlich eine parallele Leiterbahn…
Teilbild 1: Eine empfindliche Stelle der parasitären Einkopplung beim Opamp ist der invertierende Eingang, weil dieser, als virtueller GND, auf einen niedrigen Strom empfindlich reagiert und so in R2 und somit auch am Ausgang Ua die Störspannung Us verstärkt wiedergibt. Ähnliches gilt bei nichtinvertierendem Eingang, jedoch ist die Funktionsweise etwas anders. Der Strom wirkt direkt auf R3. Die Störspannung liegt an R3 und wird durch „(R2/R1)+1“ verstärkt. Us ist die Stör- oder im Speziellen die 50-Hz-Brummspannung. Der Zeigefinger illustriert das spielerische Experiment. Je näher der Zeigefinger beim invertierenden oder nichtinvertierenden Eingang ist, um so grösser ist die Kapazität Cx im unteren pf-Bereich.
Teilbild 2: Hier geht es um eine reale Störsituation. Der punktierte Bereich der beiden parallelen Leiterbahnen bilden die Kapazität Cx. Wenn Us eine Rechteckspannung im unteren Volt-Bereich aufweist, z.B. als Teil einer benachbarten digitalen Schaltung, dann wird Us im Bereich von Cx in den Abschnitt der Leiterbahn zum invertierenden Eingang eingekoppelt mit der entsprechenden Auswirkung auf Ua. Der nichtinvertierende Eingang ist hier mit GND verbunden, weil nur die Störspannung zum Ausdruck kommen soll. Warum diese als feine Nadelimpulse gezeichnet sind, erfährt man im Minikurs.
Die Teilbilder 3 bis 5 zeigen, dass die Bahnlänge zum invertierenden Eingang so kurz wie möglich gehalten werden sollte. Dies erreicht man, wenn die Bauteile (hier R1 und R2) möglichst nahe beim invertierenden Eingang verlötet sind. Häufig verwendet man zur Kalibrierung oder Steuerung der Verstärkung eine Kombination aus Widerstand und (Trimm-)Potmeter. Es versteht sich von selbst, dass R2 so nahe wie möglich beim invertierenden Eingang liegt.
Viel Spass beim Lesen des neuen vierten Opamp-Minikurses.
Gruss Euer
ELKO-Thomas