 Dieser Elektronik-Minikurs ergänzt den ersten (2. Link) mit dem Unterschied, dass bei diesem die Speisung der Schaltung direkt aus dem 230-VAC-Netz erfolgt. Ein Vorteil mit nur einer galvanischen Trennung, wie nebenstehend das Titelbild illustriert.
Dieser Elektronik-Minikurs ergänzt den ersten (2. Link) mit dem Unterschied, dass bei diesem die Speisung der Schaltung direkt aus dem 230-VAC-Netz erfolgt. Ein Vorteil mit nur einer galvanischen Trennung, wie nebenstehend das Titelbild illustriert.
Um den Inhalt dieses zweiten Elektronik-Minikurses über die Einschaltstrombegrenzung, inklusive Heissleiter und Trafo, richtig zu verstehen, sind die Kenntnisse des ersten (2. Link) nowendig. Der grosse Vorteil der Speisung der Elektronik zur Einschaltstrombegrenzung aus dem 230-VAC-Netz ist, dass das Relais, dessen Arbeitskontakt nach der Einschaltung verzögert den Heissleiter (NTC) überbrückt, keine speziellen Isolationseigenschaften aufweisen muss. Das Relais ist für keine galvanische Trennung verantwortlich. Es ist daher möglich ein beliebiges 230-VAC-taugliches Relais zu verwenden, das von verschiedenen Herstellern erhältlich ist. Die Funktionsweise der Einschaltstrombegrenzung mit Schaltung und Diagramm wird anschaulich erklärt.
Besonders bei medizinischen Anwendungen sind solche Vorteile besonders wichtig, weil neben der höheren Anforderung an Isolationsspannung, auch ein besonders geringer Erd-, bzw. Patientenableitstrom wichtig ist. Da kann der Entwickler eines Netzteiles für medizinische Spezifikationen froh sein, wenn man nicht auch noch um das Relais besorgt sein muss.
Es gehört zwar nicht zum Thema, trotzdem wird auch noch die Daten-Schnittstelle zwischen Computer/Internet und medizin-sensitiver elektronischer Schaltung unter die Lupe genommen und es wird grob gezeigt welche Massnahmen sich bieten.

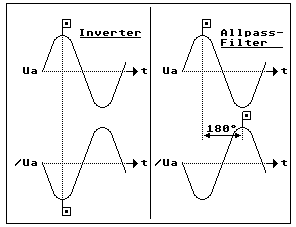 Der Unterschied zwischen einer Signal-Inversion und einer Phasenverschiebung von 180 Grad war bisher zuwenig deutlich erklärt…
Der Unterschied zwischen einer Signal-Inversion und einer Phasenverschiebung von 180 Grad war bisher zuwenig deutlich erklärt…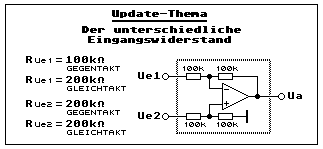 Vollständig neu überarbeitet ist das Kapitel
Vollständig neu überarbeitet ist das Kapitel 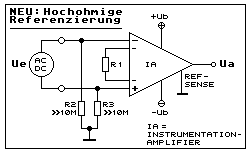 Dieser Elektronik-Minikurs erweitert ECHTER DIFFERENZVERSTÄRKER I mit dem Haupthema der Referenzierung der Spannungsquelle am Eingang des Instrumentationsverstärkers und die Referenzierung am eigentlichen (IC-internen) Differenzverstärker (REF-SENSE).
Dieser Elektronik-Minikurs erweitert ECHTER DIFFERENZVERSTÄRKER I mit dem Haupthema der Referenzierung der Spannungsquelle am Eingang des Instrumentationsverstärkers und die Referenzierung am eigentlichen (IC-internen) Differenzverstärker (REF-SENSE).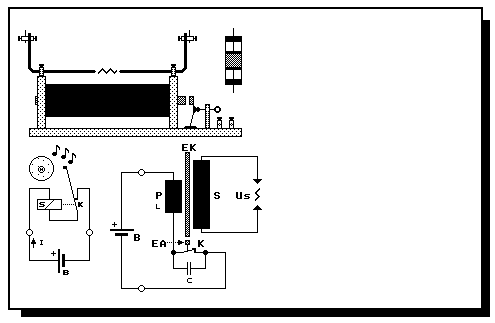 Seit einigen Monaten existierte der wichtige Link DRAHTLOSE TELEGRAPHIE MIT GEDÄMPFTEN WELLEN nicht mehr. Ich habe ihn mehr zufällig an einem andern Ort wiederentdeckt. Er ist in diesem Elektronik-Minikurs wieder verfügbar.
Seit einigen Monaten existierte der wichtige Link DRAHTLOSE TELEGRAPHIE MIT GEDÄMPFTEN WELLEN nicht mehr. Ich habe ihn mehr zufällig an einem andern Ort wiederentdeckt. Er ist in diesem Elektronik-Minikurs wieder verfügbar.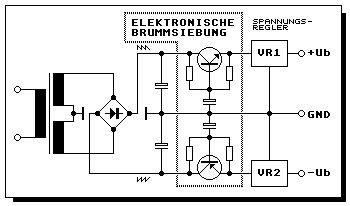
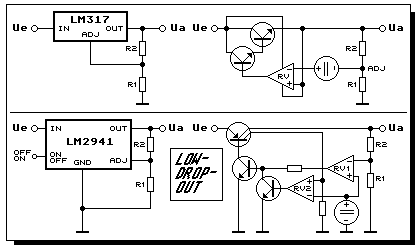 Diesen Elektronik-Minikurs gibt es seit Mai 2002. Jetzt kam es zu einem grösseren Update, wobei mit Bild 6 eine weitere Skizze dazu kam. Der Text ist ebenfalls überarbeitet.
Diesen Elektronik-Minikurs gibt es seit Mai 2002. Jetzt kam es zu einem grösseren Update, wobei mit Bild 6 eine weitere Skizze dazu kam. Der Text ist ebenfalls überarbeitet.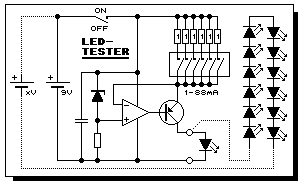 Dieser Elektronik-Minikurs ist im Text neu überarbeitet und verständlicher und geht, dort wo es wichtig ist, besser in’s Detail.Man erlernt das Prinzip dieser Konstantstromquelle und am Schlusskann jeder seine eigene LED-Testschaltung bauen und versteht wiesie funktioniert. Das kleine Bild deutet an, wie die Konstantstromquelle, bzw, der LED-Tester arbeitet. Mit einer Zusatzspannungsquelle können leicht auch lange LED-Ketten getestet werden.
Dieser Elektronik-Minikurs ist im Text neu überarbeitet und verständlicher und geht, dort wo es wichtig ist, besser in’s Detail.Man erlernt das Prinzip dieser Konstantstromquelle und am Schlusskann jeder seine eigene LED-Testschaltung bauen und versteht wiesie funktioniert. Das kleine Bild deutet an, wie die Konstantstromquelle, bzw, der LED-Tester arbeitet. Mit einer Zusatzspannungsquelle können leicht auch lange LED-Ketten getestet werden.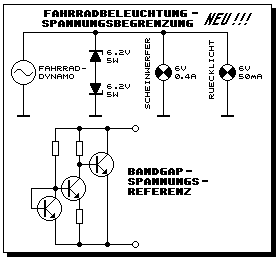 Dieser Elektronik-Minikurs erweitert von Patrick Schnabel den Grundlagenkurs über Z-Dioden. Dort geht es um die elektronische Grundlage der Zener-Diode (Z-Diode). In einem Diagramm wird gezeigt, wie die Z-Diode arbeitet. Die Zener-Schwellwertspannung im Normalbetrieb in der Sperrrichtung und der Durchflussspannungswert wenn die Z-Diode im Durchflussbetrieb arbeitet:
Dieser Elektronik-Minikurs erweitert von Patrick Schnabel den Grundlagenkurs über Z-Dioden. Dort geht es um die elektronische Grundlage der Zener-Diode (Z-Diode). In einem Diagramm wird gezeigt, wie die Z-Diode arbeitet. Die Zener-Schwellwertspannung im Normalbetrieb in der Sperrrichtung und der Durchflussspannungswert wenn die Z-Diode im Durchflussbetrieb arbeitet: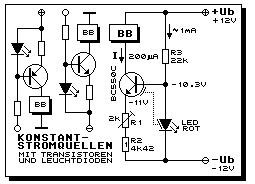 Dieser Elektronik-Minikurs habe ich derart erweitert, dass man ihn gerade so gut als neu bezeichnen kann. Was ist geblieben und was ist neu dazugekommen? Geblieben ist das Hauptthema. Es damit zu tun, dass sich Transistoren und LEDs hervorragend als einfache und recht präzise Konstant-Stromquellen eignen.
Dieser Elektronik-Minikurs habe ich derart erweitert, dass man ihn gerade so gut als neu bezeichnen kann. Was ist geblieben und was ist neu dazugekommen? Geblieben ist das Hauptthema. Es damit zu tun, dass sich Transistoren und LEDs hervorragend als einfache und recht präzise Konstant-Stromquellen eignen.