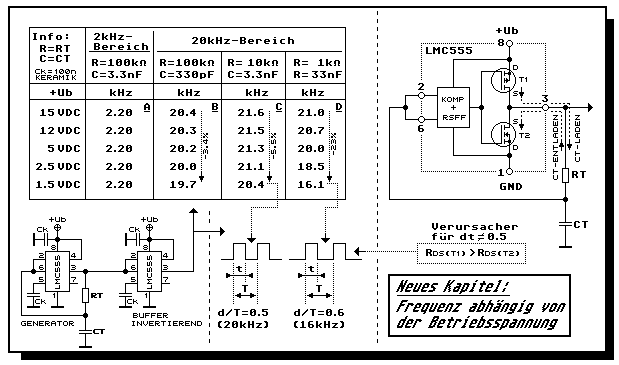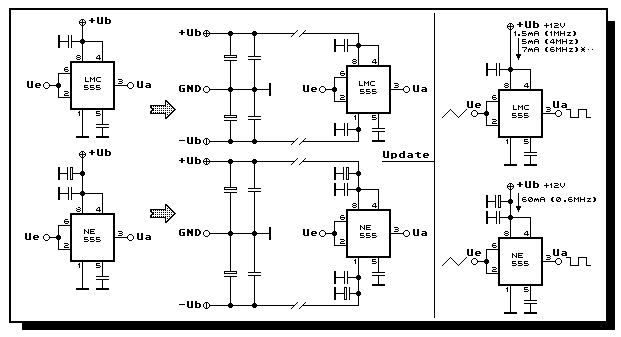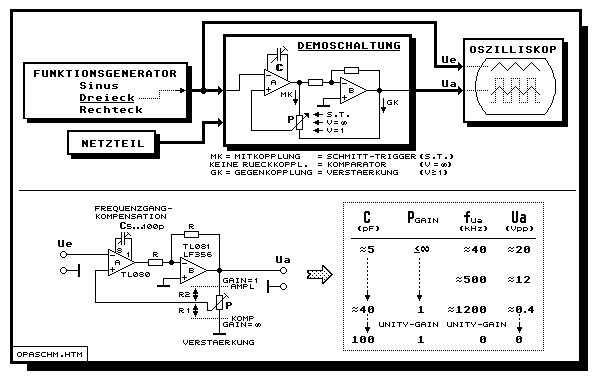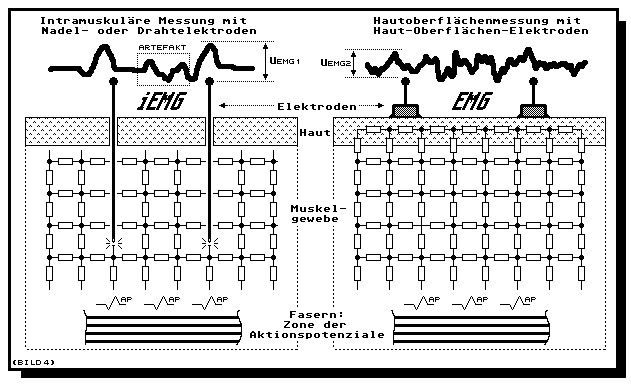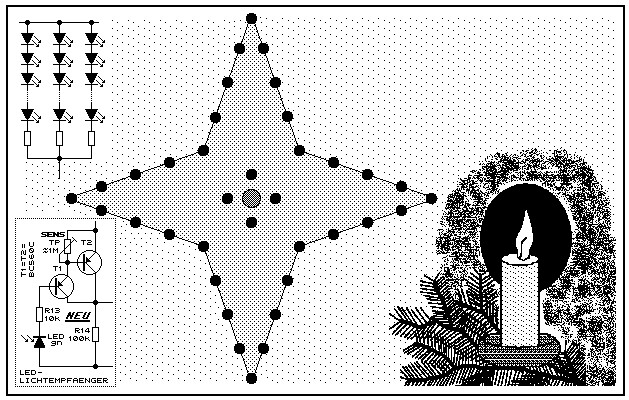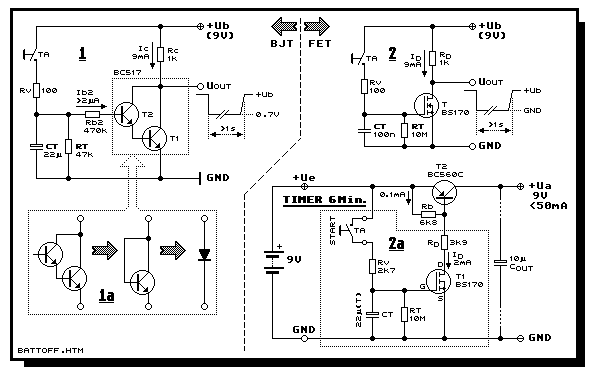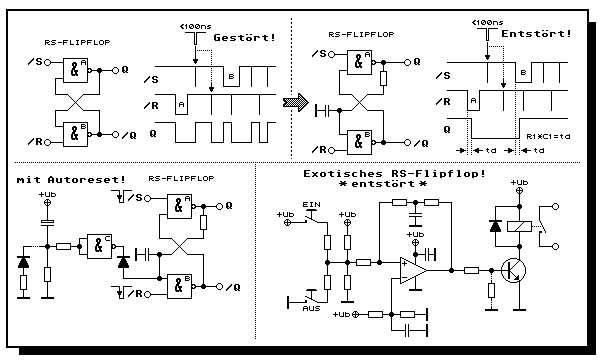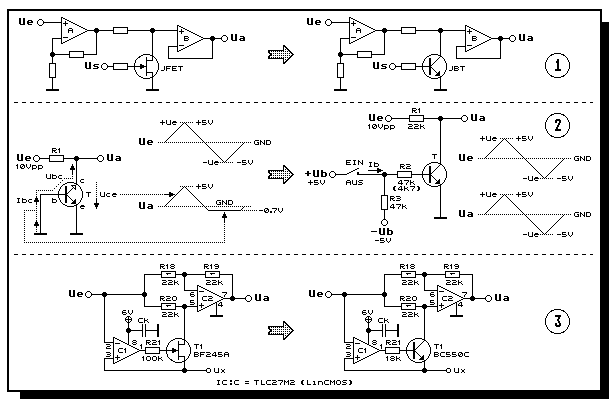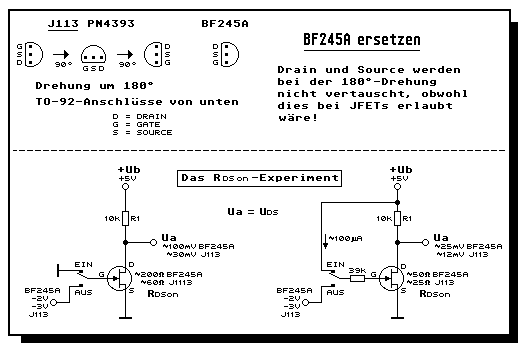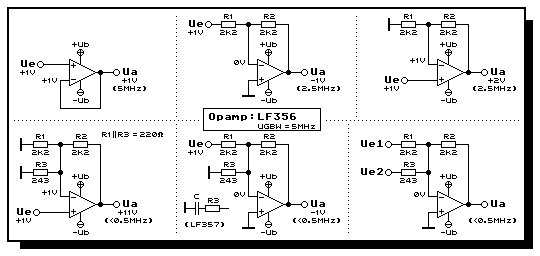/public/schaerer/bilder/ast555t2.gif
Der Inhalt wurde leicht überarbeitet und es gibt ein neues Kapitel, das mit der Stabilität der Frequenz in Funktion der Betriebsspannung zu tun hat. Diese Stabilität ist für eine RC-Generatorschaltung hervorragend, vorausgesetzt man befolgt einige Regeln. Diese Regeln habe ich aus einem Experiment in einer Tabelle zusammengefasst. Diese Tabelle und die einfache Testschaltung schmücken das Titelbild. Die genaue Erklärung dazu folgt in diesem Elektronik-Minikurs.
Wenn man solche Experimente durchführt ist es wichtig, dass der Ausgang des LMC555-Generators nicht durch die Messleitung zum Oszilloskopen kapazitiv belastet wird und so die Messung negativ beeinflusst. Ein einfacher Buffer besteht darin, dass man ein einen zweiten LMC555 (oder TLC555) in seiner Schmitt-Trigger-Eigenschaft als Buffer verwendet. Das ist sehr einfach und erst noch elegant, wenn man die Messung von der minimalen (1.5 VDC) bis zur maximalen (15 VDC) Betriebsspannung durchführen will.
Es gibt Leute die den Unterschied nicht kennen zwischen einem LM555C und LMC555. LM555C ist kein Schreibfehler. Es gibt ihn tatsächlich und es ist die selbe bipolare Version wie der NE555. Der LMC555 ist die CMOS-Version. Auch das wird hier mal deutlich erklärt und mit Datenblatt-Links dokumentiert.
Kurz das Hauptthema zusammengefasst: Es geht um den bekannten Rechteckgenerator mit einem Tastgrad von 0.5 in der CMOS-Version des Timer-IC 555 LMC555 oder TLC555. Als frequenzbestimmende Bauteile benötigt es nur einen Kondensator und einen Widerstand. Als praktische Anwendung wird die kapazitive Feuchtemessung erklärt, die man ohne grossen Aufwand selbst realisieren kann.
Der Timing-Kondensator ist der kapazitiver Feuchtesensor. Die Luftfeuchtigkeit beeinflusst die Kapazität des Sensors und diese die Frequenz am Ausgang des LMC555 oder TLC555. Sonderbar ist, dass dieser kapazitive Sensor mit einem zusätzlichen Kondensator in Serie und parallel mit einem Widerstand beschaltet ist. Warum das so sein muss, wird im Kapitel „ANWENDUNG: KAPAZITIVE SENSORSCHALTUNG MIT LMC555“ genau erklärt.
Gruss und viel Spass
der ELKO-Thomas