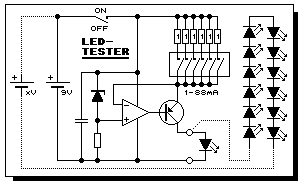 Dieser Elektronik-Minikurs ist im Text neu überarbeitet und verständlicher und geht, dort wo es wichtig ist, besser in’s Detail.Man erlernt das Prinzip dieser Konstantstromquelle und am Schlusskann jeder seine eigene LED-Testschaltung bauen und versteht wiesie funktioniert. Das kleine Bild deutet an, wie die Konstantstromquelle, bzw, der LED-Tester arbeitet. Mit einer Zusatzspannungsquelle können leicht auch lange LED-Ketten getestet werden.
Dieser Elektronik-Minikurs ist im Text neu überarbeitet und verständlicher und geht, dort wo es wichtig ist, besser in’s Detail.Man erlernt das Prinzip dieser Konstantstromquelle und am Schlusskann jeder seine eigene LED-Testschaltung bauen und versteht wiesie funktioniert. Das kleine Bild deutet an, wie die Konstantstromquelle, bzw, der LED-Tester arbeitet. Mit einer Zusatzspannungsquelle können leicht auch lange LED-Ketten getestet werden.
Man lernt schrittweise die Wirkungsweise dieser Konstantstromquelle kennen. Es beginnt mit der einfachsten Opamp-Schaltung, mit dem Impedanzwandler. Im folgenden Schritt wird erst eine Diode im Gegekopplungspfad eingebaut und wir analysieren die Spannungen. Im nächsten Schritt wird an Stelle der Diode die Basis-Emitterstrecke eines Transistors eingebaut und ein Widerstand zwischen Emitter und GND definiert in Abhängigkeit der Eingangsspannung den konstanten Kollektorstrom. Konstant im Sinne davon, dass der Strom unabhängig desWiderstandes im Kollektorkreis auf einem stabilen Wert bleibt. Damit ist die Konstantstromquelle realisiert. So ideal wie es jetzt aussieht, ist es aber trotzdem nicht, wenn man es ganz genau nimmt: Stichwort Early-Effekt, dessen Auswirkung kurz erklärt wird.
Im nächsten Schritt erlernt man die Unterschiede der bipolaren Opamps, nämlich solche mit NPN- und PNP-Eingangs-Transistoren. Und man lernt, warum sich in diesem Projekt nur Opamps mit NPN-Eingangs-Transistoren, von denen es sehr viele gibt, eignen. Es wird aber auch gezeigt, dass durchaus auch gewisse BiFET-Opamps in Frage kommen. Dieser Elektronik-Minikurs geht, was den Eingangsteil betrifft, etwas auf die Opamptopologie ein.
Im nächsten Schritt folgt die vollständige Dimensionierung einer solchen Konstantstromquelle und im letzten Teil folgt die Schaltung eines nachbaubaren des LED-Testers mit umschaltbaren Konstantströmen mit Werten 1, 2, 5, 10, 20 und 50 mA. Durch Kombination der Schalter sind auch Zwischenwerte und höhere Werte möglich. Sind alle Schalter eingeschaltet, beträgt der konstante LED-Strom 88 mA.
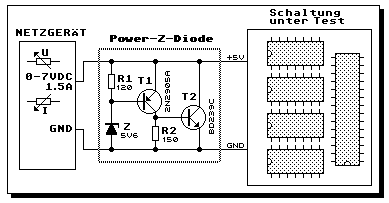

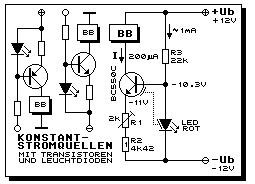 Dieser Elektronik-Minikurs habe ich derart erweitert, dass man ihn gerade so gut als neu bezeichnen kann. Was ist geblieben und was ist neu dazugekommen? Geblieben ist das Hauptthema. Es damit zu tun, dass sich Transistoren und LEDs hervorragend als einfache und recht präzise Konstant-Stromquellen eignen.
Dieser Elektronik-Minikurs habe ich derart erweitert, dass man ihn gerade so gut als neu bezeichnen kann. Was ist geblieben und was ist neu dazugekommen? Geblieben ist das Hauptthema. Es damit zu tun, dass sich Transistoren und LEDs hervorragend als einfache und recht präzise Konstant-Stromquellen eignen.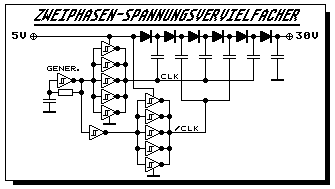
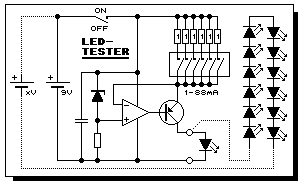 Dieser Elektronik-Minikurs ist im Text neu überarbeitet und verständlicher und geht, dort wo es wichtig ist, besser in’s Detail.Man erlernt das Prinzip dieser Konstantstromquelle und am Schlusskann jeder seine eigene LED-Testschaltung bauen und versteht wiesie funktioniert. Das kleine Bild deutet an, wie die Konstantstromquelle, bzw, der LED-Tester arbeitet. Mit einer Zusatzspannungsquelle können leicht auch lange LED-Ketten getestet werden.
Dieser Elektronik-Minikurs ist im Text neu überarbeitet und verständlicher und geht, dort wo es wichtig ist, besser in’s Detail.Man erlernt das Prinzip dieser Konstantstromquelle und am Schlusskann jeder seine eigene LED-Testschaltung bauen und versteht wiesie funktioniert. Das kleine Bild deutet an, wie die Konstantstromquelle, bzw, der LED-Tester arbeitet. Mit einer Zusatzspannungsquelle können leicht auch lange LED-Ketten getestet werden.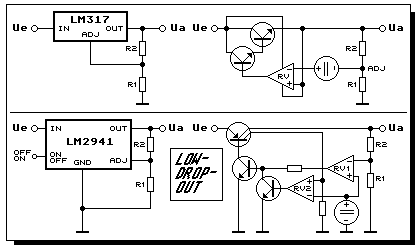 Diesen Elektronik-Minikurs gibt es seit Mai 2002. Jetzt kam es zu einem grösseren Update, wobei mit Bild 6 eine weitere Skizze dazu kam. Der Text ist ebenfalls überarbeitet.
Diesen Elektronik-Minikurs gibt es seit Mai 2002. Jetzt kam es zu einem grösseren Update, wobei mit Bild 6 eine weitere Skizze dazu kam. Der Text ist ebenfalls überarbeitet.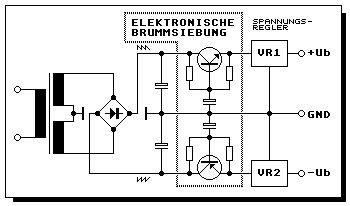
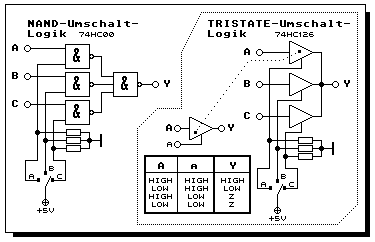 Hochkomplexe integrierte digitale Schaltungen ohne die Anwendung der Tristate-Logik ist undenkbar…
Hochkomplexe integrierte digitale Schaltungen ohne die Anwendung der Tristate-Logik ist undenkbar… Das Wort MonoFlipflop ist eine Wortschöpfung von mir, die zum Ausdruck bringt, dass hier eine Schaltung sowohl Flipflop als auch Monoflop ist.
Das Wort MonoFlipflop ist eine Wortschöpfung von mir, die zum Ausdruck bringt, dass hier eine Schaltung sowohl Flipflop als auch Monoflop ist.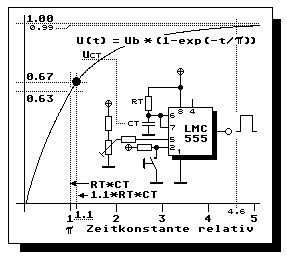 Der 555-Timer ist ein Oldy. Wer kennt ihn nicht. Es gibt viel Literatur und nicht wenige Webseiten mit Grundlagen und praktischen Anwendungen zu diesem noch heute sehr beliebten, originellen und vielseitigen Timerbaustein. Auch das ELKO ist dem 555 stark involviert, das man leicht feststellen kann, wenn man im Suchfenster 555 eingibt.
Der 555-Timer ist ein Oldy. Wer kennt ihn nicht. Es gibt viel Literatur und nicht wenige Webseiten mit Grundlagen und praktischen Anwendungen zu diesem noch heute sehr beliebten, originellen und vielseitigen Timerbaustein. Auch das ELKO ist dem 555 stark involviert, das man leicht feststellen kann, wenn man im Suchfenster 555 eingibt.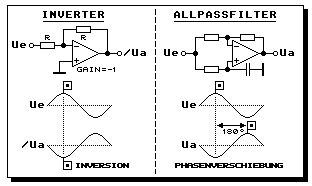 Im letzten Newsletter vor drei Monaten wurde darauf hingewiesen, dass der Unterschied zwischen Signal-Inversion und Phasenverschiebung von 180 Grad besser beschrieben wurde. Neu kommt hier hinzu, dass das Beispiel Allpassfilter deutlicher erklärt wird.
Im letzten Newsletter vor drei Monaten wurde darauf hingewiesen, dass der Unterschied zwischen Signal-Inversion und Phasenverschiebung von 180 Grad besser beschrieben wurde. Neu kommt hier hinzu, dass das Beispiel Allpassfilter deutlicher erklärt wird.