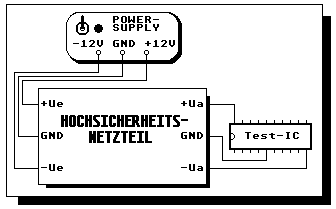 Je länger desto mehr werden an technischen Hochschulen und in Elektronikfirmen integrierte CMOS-Schaltungen entwickelt. Man nennt diese „Disziplin“ IC-Design. Die Arbeit erfolgt mit komplizierter Software an Computern. Die ultimativen Daten sendet man einer Halbleiterherstellerfirma via Internet. Diese Firma stellt eine Nullserie der intergrierten Schaltung her, die dem Entwickler per Paketpost – das Beamen ist noch nicht erfunden! 😉 – zum Testen zurückgesendet wird. Es naht die Stunde der Wahrheit. Die Nerven werden strapaziert. Und dann, welch ein wohltuendes Aufatmen, wenn festgestellt wird, dass alle Parameter stimmen. Die Korkenzapfen fliegen!
Je länger desto mehr werden an technischen Hochschulen und in Elektronikfirmen integrierte CMOS-Schaltungen entwickelt. Man nennt diese „Disziplin“ IC-Design. Die Arbeit erfolgt mit komplizierter Software an Computern. Die ultimativen Daten sendet man einer Halbleiterherstellerfirma via Internet. Diese Firma stellt eine Nullserie der intergrierten Schaltung her, die dem Entwickler per Paketpost – das Beamen ist noch nicht erfunden! 😉 – zum Testen zurückgesendet wird. Es naht die Stunde der Wahrheit. Die Nerven werden strapaziert. Und dann, welch ein wohltuendes Aufatmen, wenn festgestellt wird, dass alle Parameter stimmen. Die Korkenzapfen fliegen!
Bevor es aber soweit ist, sollten Maßnahmen getroffen werden, dass beim Testen nicht unabsichtlich ein zu testendes IC zerstört wird. Da gilt es dafür zu sorgen, dass keine statischen Entladungen auftreten können. Oft ist es so, dass selbsthergestellte CMOS-ICs nicht die hohen Ein- und Ausgangssicherheiten aufweisen, wie z.B. die 74HC(T)xxxx-, CD4xxx und MC14xxx-CMOS-Familien. Ein grosses Problem ist das Risiko des Latchup-Effekts. Um dieses zerstörerische Risiko so gering wie möglich zu halten, lohnt es sich ein dafür spezielles Netzteil zu realisieren! Dies ist das Thema dieses Elektronik-Minikurses.
Da dieser Elektronik-Minikurs leicht überarbeitet wurde und heute brandaktueller ist als vor vier Jahren, als ich ihn geschrieben habe, wird im ELKO-Newsletter erneut darauf aufmerksam gemacht.
Elektronik-Inhalte: Spannungsregelschaltung mit Opamp und Transistor. Das Dual-Tracking-Prinzip bei symmtrischer Spannungsregelung. Strombegrenzung mit Transistor. Überstromabschaltung mit Verzögerungsschaltung (Trägheit), RS-Flipflop, Transistor und Relais. Überspannungsbegrenzung die sich der Einstellung der Ausgangsspannung automatisch anpasst. Gleichbleibend helle Spannungsanzeige mit LEDs bis zu einer niedrigen Betriebsspannung von 0.7 VDC.

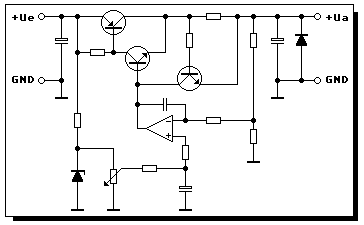
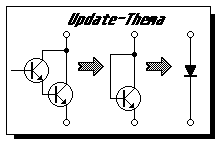 Dieser Elektronik-Minikurs über Lowpower-MOSFETs ist auf eine spezielle Anwendung, auf die Verzögerungsschaltung, oft auch Timer genannt, fixiert. Trotzdem eignet sich dieser Inhalt um die erworbenen Grundlagen über diese Art von Feldeffekttransistoren zusätzlich zu vertiefen. Für den Leser der noch nicht weiss was ein Feldeffekttransistor (FET) ist, empfehlen sich die entsprechenden Grundlagenkurse von Patrick Schnabel. Diese findet man schnell mit der ELKO-Suchfunktion durch die Eingaben von Feldeffekt-Transistor, MOS-Schaltkreisfamilie und MOS-FET. Dieser Elektronik-Minikurs befasst sich speziell mit dem BS170, der sehr bekannt und beliebt ist. Er wird scherzhaft oft auch den BC109 der MOSFET-Familien genannt, obwohl er dem BC109 um einiges überlegen ist.
Dieser Elektronik-Minikurs über Lowpower-MOSFETs ist auf eine spezielle Anwendung, auf die Verzögerungsschaltung, oft auch Timer genannt, fixiert. Trotzdem eignet sich dieser Inhalt um die erworbenen Grundlagen über diese Art von Feldeffekttransistoren zusätzlich zu vertiefen. Für den Leser der noch nicht weiss was ein Feldeffekttransistor (FET) ist, empfehlen sich die entsprechenden Grundlagenkurse von Patrick Schnabel. Diese findet man schnell mit der ELKO-Suchfunktion durch die Eingaben von Feldeffekt-Transistor, MOS-Schaltkreisfamilie und MOS-FET. Dieser Elektronik-Minikurs befasst sich speziell mit dem BS170, der sehr bekannt und beliebt ist. Er wird scherzhaft oft auch den BC109 der MOSFET-Familien genannt, obwohl er dem BC109 um einiges überlegen ist.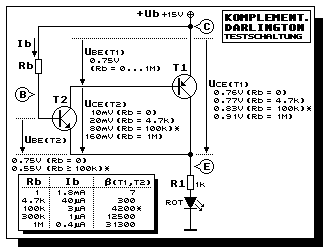
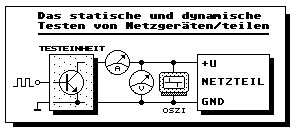 Wie realisert man ein Testgerät für Netzteile und Netzgeräte um ihre statischen und dynamischen Regeleigenschaften zu testen? Ein überarbeiteter Elektronik-Minikurs, u.a. mit einer nachbaubaren Schaltung!
Wie realisert man ein Testgerät für Netzteile und Netzgeräte um ihre statischen und dynamischen Regeleigenschaften zu testen? Ein überarbeiteter Elektronik-Minikurs, u.a. mit einer nachbaubaren Schaltung!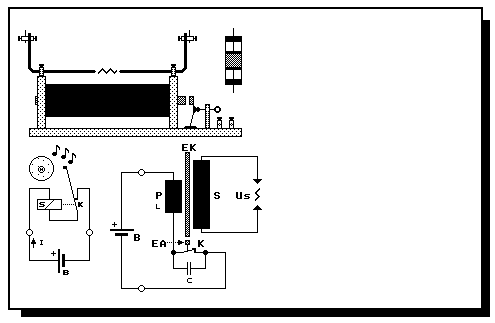 Seit einigen Monaten existierte der wichtige Link DRAHTLOSE TELEGRAPHIE MIT GEDÄMPFTEN WELLEN nicht mehr. Ich habe ihn mehr zufällig an einem andern Ort wiederentdeckt. Er ist in diesem Elektronik-Minikurs wieder verfügbar.
Seit einigen Monaten existierte der wichtige Link DRAHTLOSE TELEGRAPHIE MIT GEDÄMPFTEN WELLEN nicht mehr. Ich habe ihn mehr zufällig an einem andern Ort wiederentdeckt. Er ist in diesem Elektronik-Minikurs wieder verfügbar.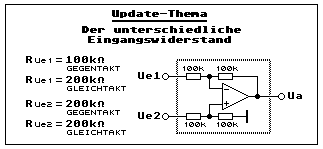 Vollständig neu überarbeitet ist das Kapitel
Vollständig neu überarbeitet ist das Kapitel 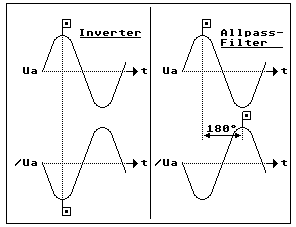 Der Unterschied zwischen einer Signal-Inversion und einer Phasenverschiebung von 180 Grad war bisher zuwenig deutlich erklärt…
Der Unterschied zwischen einer Signal-Inversion und einer Phasenverschiebung von 180 Grad war bisher zuwenig deutlich erklärt… Dieser Elektronik-Minikurs ergänzt den ersten (2. Link) mit dem Unterschied, dass bei diesem die Speisung der Schaltung direkt aus dem 230-VAC-Netz erfolgt. Ein Vorteil mit nur einer galvanischen Trennung, wie nebenstehend das Titelbild illustriert.
Dieser Elektronik-Minikurs ergänzt den ersten (2. Link) mit dem Unterschied, dass bei diesem die Speisung der Schaltung direkt aus dem 230-VAC-Netz erfolgt. Ein Vorteil mit nur einer galvanischen Trennung, wie nebenstehend das Titelbild illustriert.