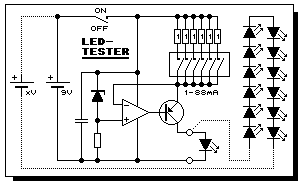Dem Elektroniker ist Tantal ein Begriff. Es ist ein wichtiges, allerdings auch ein selten vorkommendes Metall, das in hochwertigen Elektrolytkondensatoren zum Einsatz kommt. Man setzt diese, meist tropfenförmigen Tantal-Elkos, die sich oft in den Farben blau und orange präsentieren, dort ein, wo bei relativ grossen Kapazitäten kleine Verluste verlangt sind, wie z. B. in präzisen Timerschaltungen mit langen Zeiten. Ebenso für Filterschaltungen mit sehr niedrigen Grenzfrequenzen sind sie oft die ideale Lösung. Hohe Kapazitäten, hohe Qualitäten und kleine Masse.
Kaum jemand weiss allerdings, welch hohen Blutzoll, auch mit diesem seltenen Stoff verbunden ist. Nicht nur Diamanten und Gold, nein auch Tantal gehört zu diesen „schwarzen Schafen“ und dass dabei wieder einmal der schwarze Kontinent für die Ausbeutung durch die „Weissen“ herhalten muss, ist leider eine weitere sehr traurige Realität. Aber lesen Sie bitte selbst, den von mir zitierten Artikel aus der NEXUS-Zeitschrift, Ausgabe Juni/Juli 2006, Seite 11, mit dem Titel HIGH-TECH-GENOZIT:
Über vier Millionen Menschen sind in Zentralafrika im Krieg um Coltan bereits ums Leben gekommen. Coltan steht kurz für Columbit-Tantalit und ist ein hitzeresistentes Mineralerz, das vor allem für Mobilfunktelefone, Laptops und sonstige Elektronik benötigt wird. Das aus dem Erz gewonnene Tantal wird für die Herstellung von Tantal-Elektrolytkondensatoren verwendet. 80 Prozent des weltweiten Coltanvorrats lagern in der Demokratischen Republik Kongo.
Dieses von Gebirge und Dschungel geprägte Gebiet ist der Schauplatz des Krieges, dem man den finsteren Namen „Erster Weltkrieg Afrikas“ gegeben hat und bei dem die kongolesischen Streitkräfte gegen die von sechs Nachbarländern sowie zahlreiche bewaffnete Gruppen kämpfen. Die Opfer sind weitgehend Zivilisten; Hunderttausende sind bereits durch Hunger und Krankheiten gestorben, und die Auseinandersetzungen haben zwei Millionen Menschen heimatlos gemacht.
Obwohl er oft verharmlosend als ethnischer Krieg dargestellt wird, ist der Konflikt in Wahrheit ein Kampf um die Rohstoffe, die bei ausländischen Konzernen heissbegehrt sind: Diamanten, Zinn, Kupfer, Gold und vor allem Coltan. Hintergrund des Kampfes zwischen den schwerbewaffneten Milizen und den verschiedenen Regierungen ist ein Abbrechen des High-Tech-Booms, der in den 1990ern begann und den Preis für Coltan auf knapp 300 US-Dollar pro Pfund hochtrieb.
Soviel aus der Zeitschrift NEXUS. Dem ist kaum noch etwas beizufügen, als darauf hinzuweisen, warum ich diesen Inhalt in den ELKO-Newsletter übernommen habe. Ich denke, es schadet nicht nur nichts, es dient der Sensibilisierung unseres Bewusstseins in der Weise, dass wir immer auch wieder einmal daran denken, dass auch wir unseren Teil dazu beitragen, dass der Fortschritt der „westlichen“ Technologie/Kultur sich zum Nachteil den menschlichen Kulturen auswirkt, welche unter diesem post-kolonialen Szenarium noch heute schmerzhaft zu leiden haben.
Es kommt eben auch sehr darauf an, wie man Fortschritt definiert. Ich definiere ihn, dass das was getan wird allen Menschen zugute kommt, niemand ausgebeutet wird und der Natur nicht schadet. Mögen wir manchmal daran denken, wenn wir gerade wieder dabei sind Tantal-Elkos in eine Printplatte einzulöten…
Es grüsst
der ELKO-Thomas
/public/schaerer/

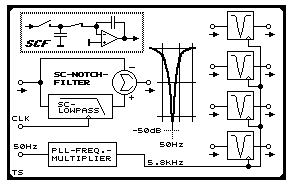 Ein 50-Hz-Notchfilter setzt man ein um Störeinflüsse der Netzspannung zu unterdrücken. Eine Filterbank besteht aus vielen solchen Filtern, hier in SC-Technik.
Ein 50-Hz-Notchfilter setzt man ein um Störeinflüsse der Netzspannung zu unterdrücken. Eine Filterbank besteht aus vielen solchen Filtern, hier in SC-Technik.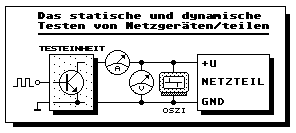 Wie realisert man ein Testgerät für Netzteile und Netzgeräte um ihre statischen und dynamischen Regeleigenschaften zu testen? Ein neuer Elektronik-Minikurs, u.a. mit einer nachbaubaren Schaltung!
Wie realisert man ein Testgerät für Netzteile und Netzgeräte um ihre statischen und dynamischen Regeleigenschaften zu testen? Ein neuer Elektronik-Minikurs, u.a. mit einer nachbaubaren Schaltung! Die Hauptsätze der Thermodynamik, kurz und bündig erklärt. Ein Buchauszug…
Die Hauptsätze der Thermodynamik, kurz und bündig erklärt. Ein Buchauszug…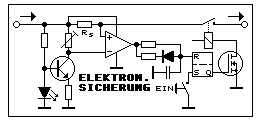 Teil I befasst sich mit den Grundlagen einer Stromsensorschaltung auf einer DC-Speisespannung mittels eines Opamp und Teil II beinhaltet eine nachbaubare elektronische Sicherung nach dem selben Prinzip.
Teil I befasst sich mit den Grundlagen einer Stromsensorschaltung auf einer DC-Speisespannung mittels eines Opamp und Teil II beinhaltet eine nachbaubare elektronische Sicherung nach dem selben Prinzip. Dieser neue Elektronik-Minikurs ist eine Erweiterung des bestehenden zweiteiligen Kurses mit dem Titel
Dieser neue Elektronik-Minikurs ist eine Erweiterung des bestehenden zweiteiligen Kurses mit dem Titel