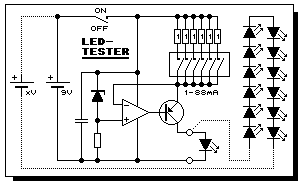Dieser Elektronik-Minikurs, der seit 26.06.2002 besteht, wurde mit dem Ziel überarbeitet, dass der Inhalt verständlicher wird. Neu sind auch viele Links, die auf andere geeignete und teils ergänzende Elektronik-Minikurse hinweisen.
Dieser Elektronik-Minikurs, der seit 26.06.2002 besteht, wurde mit dem Ziel überarbeitet, dass der Inhalt verständlicher wird. Neu sind auch viele Links, die auf andere geeignete und teils ergänzende Elektronik-Minikurse hinweisen.
Es hat sich gezeigt, dass viele Elektronikanfänger Probleme haben die Elektronik-Minikurse über die echten Differenzverstärker zu verstehen. Dies kommt davon, dass grundlegendes Wissen über den Operationsverstärker (Opamp) oft fehlt. Die Grundlagen von Patrick Schnabel vermitteln u.a. das Wissen wie man einfache invertierende und nichtinvertierende Verstärkerschaltungen berechnet. Das ist gut und wichtig. Diese Links findet man, wie bisher, in diesem Elektronik-Minikurs gleich zu Beginn in der Einleitung.
Allerdings ermöglicht dieses Wissen noch nicht zu verstehen, wie eine Verstärkerschaltung mit einem Opamp wirklich funktioniert. Dazu genügen Formeln und Zahlen alleine nicht. Man muss eine solche Schaltung anschauen und es gehören Worte dazu mit denen das Verständnis vermittelt und vertieft wird.
Opamps sind wesentlich komplexer als es beim Elektronikbeginner (Azubi) den Anschein erweckt. Dies kommt hier darin zum Ausdruck, dass ein Kapitel sich nicht nur gerade auf den Titel beschränkt. So steht im ersten Kapitel das Thema der virtuellen Masse (GND) auch in einem gewissen Zusammenhang mit der Geschwindigkeit des Opamp und dessen Regeleigenschaft wenn die Gegenkopplung wirkt. Dieses Thema wird im neuesten Elektronik-Minikurs III vertieft.
Es geht aber auch um die Dimensionierung einfacher Verstärkerschaltungen, die Gleichspannungen (DC-Spannungen) und Wechselspannungen (AC-Spannungen) oder nur AC-Spannungen verstärken. Man lernt dabei worauf es ankommt, wie eine solche Schaltung bei bipolarer Speisung (±Ub und GND) oder bei unipolarer Speisung (+Ub und GND) richtig betrieben wird und wie eine zusätzliche Schaltung zur DC-Offsetkompensation realisiert und eingesetzt wird. Dieses Thema wird aber speziell in II (siehe zweiter Link) vertieft.
Ebenfalls thematisiert wird hier der Aussteuerungsbereich des Opamp und was man tun muss, damit diese symmetrisch zur Betriebsspannung erfolgt. Wenn eine Verstärkerschaltung mit bloss einer Betriebsspannung (unipolar) betrieben werden muss, darf man eine Verstärkerschaltung nicht mit GND, sondern man muss sie in der Regel mit der halben Betriebsspannung referenzieren. Es wird hier gezeigt, welche Schaltungsmethoden zu welchen Anforderungen geeignet sind. Zuletzt wird noch angedeutet wie eine Schaltung zur Erzeugung eines virtuellen GND grundsätzlich realisiert wird, die entsprechend ausgebaut, auch bei höheren Strömen im Ampere-Bereich aktiv anstelle einer bipolaren Spannungsquelle eingesetzt werden kann.
An dieser Stelle muss einmal klargestellt werden, dass die Angelegenheiten der Operationsverstärker derart umfangreich und komplex sind, dass meine Elektronik-Minikurse zu diesem Thema nie vollständig sein können und deshalb weitere Literatur hinzugezogen werden muss. Kurse im ELKO sind stets das was sie sind und sein wollen: Begleitendes und praxisorientiertes Unterrichtsmaterial.

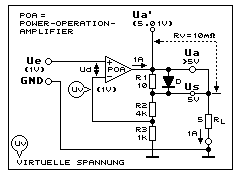 Dieser Elektronik-Minikurs über Operationsverstärker beschäftigt sich speziell mit dem Thema der virtuellen Spannung, bzw. virtuellen GND, da nicht wenige Azubis Probleme haben zu verstehen wie es dazu kommt.
Dieser Elektronik-Minikurs über Operationsverstärker beschäftigt sich speziell mit dem Thema der virtuellen Spannung, bzw. virtuellen GND, da nicht wenige Azubis Probleme haben zu verstehen wie es dazu kommt.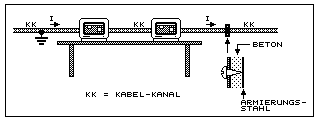 Ein Aluminium-Kabelkanal, der an der einen Seite korrekt geerdet und auf der andern Seite unkorrekt ebenfalls geerdet war, erzeugte in diesem Kanal einen unerwünschten Potenzialausgleichsstrom der zum Zittern von Monitorbildern führte…
Ein Aluminium-Kabelkanal, der an der einen Seite korrekt geerdet und auf der andern Seite unkorrekt ebenfalls geerdet war, erzeugte in diesem Kanal einen unerwünschten Potenzialausgleichsstrom der zum Zittern von Monitorbildern führte…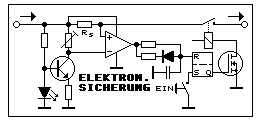 Teil I befasst sich mit den Grundlagen einer Stromsensorschaltung auf einer DC-Speisespannung mittels eines Opamp und Teil II beinhaltet eine nachbaubare elektronische Sicherung nach dem selben Prinzip.
Teil I befasst sich mit den Grundlagen einer Stromsensorschaltung auf einer DC-Speisespannung mittels eines Opamp und Teil II beinhaltet eine nachbaubare elektronische Sicherung nach dem selben Prinzip. Dieser neue Elektronik-Minikurs ist eine Erweiterung des bestehenden zweiteiligen Kurses mit dem Titel
Dieser neue Elektronik-Minikurs ist eine Erweiterung des bestehenden zweiteiligen Kurses mit dem Titel