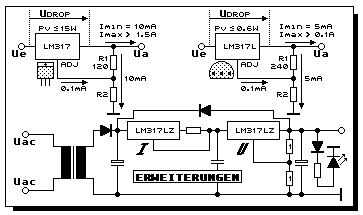
Leicht überarbeitet sind die bisherigen Kapitel zum Thema der dreibeinigen fixen (78xx, 79xx) und einstellbaren (LM317, LM337) Spannungsreglern. Dabei werden, zur Erinnerung, folgende Inhalte thematisiert: Wozu benötigt es sperrende Rücklaufdioden parallel zu den Spannungsreglern und innerhalb des spannunsgbestimmenden Netzwerkes beim LM317 und LM337, wenn die schon geringe Rippelspannung am Ausgang noch zusätzlich unterdrückt wird? Transientenunterdrückung. Symmetrische Ausgangsspannung mit LM317 und LM337. Welche schaltungstechnischen Voraussetzungen erlauben den Einsatz von Tantal-Elkos? Maximaler Ausgangsstrom in Abhängigkeit der Chip- bzw. Gehäusetemperatur und der Dropout-Spannung regelt den sicheren Arbeitsbereich des integrierten Leistungstransistor. Die Auswirkung des Temperaturdriftes des Stromes (Adjustment-Current) des Anschlusses zur Spannungseinstellung und der Referenzspannung auf die Ausgangsspannung beim LM317. Diese Werte sind beim komplementären LM337 ähnlich. Warum lohnt sich die Spannungs-Überdimensionierung von Brückengleichrichtern in Netzteilen? Kaltleiter anstelle von Sicherung. LM317 als Konstantstromquelle mit Schutzdioden und wozu das sinnvoll sein kann.
NEU: Es fällt bereits beim Titel auf, dass dieser erweitert ist. LM317L, der kleine Bruder des LM317. Beide Spannungsregler im Vergleich bezüglich Strom, Verlustleistung und minimalem Laststrom, besonders wichtig für Stromquellenschaltungen. Angeregt wurde diese Erweiterung durch häufige ELKO-Forum-Anfragen betreffs einfachen Schaltungen von Konstantstromquellen. Der LM317L bietet eine einfache und elegante Möglichkeit für kleine Ströme im mA-Bereich. Ein Akku-Ladegerät aus Stromquelle und Spannungsbegrenzung mit zwei LM317LZ, realisierbar in einem geeigneten nicht mehr gebrauchten Steckernetzteil, rundet diese Erweiterung ab. Praktische Anwendung fand diese Lade-Schaltung in einem beinahe antiquierten, aber noch immer sehr gut funktionierenden Solar-Radio des Modells AMSONIC vom Typ AS-338, zum Aufladen des eingebauten Akku, wenn zu wenig ausreichendes Sonnenlicht zur Verfügung steht. Dieses Beispiel dient der Anregung für ähnliche Kleinprojekte.
Dieser Link zeigt das Solar-Radio AMSONIC Typ: AS-339 (Nachfolge-Modell):

 Es sind jetzt mehr als zwei Jahre her, als ich an der INELTEC-2005 diesen interessanten 78xx-Spannungsregler mit 90% Wirkungsgrad kennenlernte! Er ist fast gleich gross wie der alte und traditionsreiche lineare Spannungsregler der jeder kennt. Ich erhielt damals ein Gratismuster, habe ihn zu gut versorgt 🙂 und heute eher per Zufall wieder gefunden.
Es sind jetzt mehr als zwei Jahre her, als ich an der INELTEC-2005 diesen interessanten 78xx-Spannungsregler mit 90% Wirkungsgrad kennenlernte! Er ist fast gleich gross wie der alte und traditionsreiche lineare Spannungsregler der jeder kennt. Ich erhielt damals ein Gratismuster, habe ihn zu gut versorgt 🙂 und heute eher per Zufall wieder gefunden.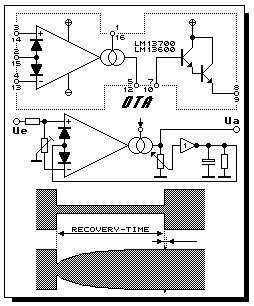
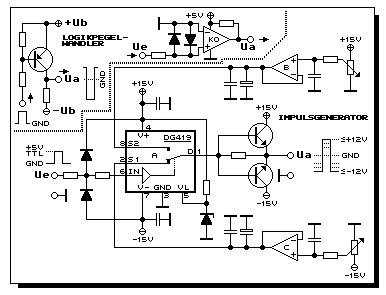

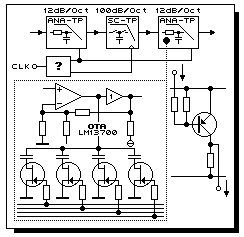 Es geht um eine Tiefpassfilterschaltung, welche in einem grossen Bereich der Grenzfrequenz mittels Taktsignal kontinuierlich steuerbar ist. Die vorliegende Schaltung in SC- und analoger Technik wurde urpsrünglich in einem aufwändigen AD-/DA-Wandlersystem computergesteuert eingesetzt. Dieses Projekt enthält Detailschaltungen die auch einzeln und in ganz anderen Zusammenhängen eingesetzt werden können: Dies sind ein einfacher Frequenz/Spannungs-Wandler ohne spezielles IC, ein Dual-Spannungs/Strom-Wandler und ein Logik-Pegelwandler.
Es geht um eine Tiefpassfilterschaltung, welche in einem grossen Bereich der Grenzfrequenz mittels Taktsignal kontinuierlich steuerbar ist. Die vorliegende Schaltung in SC- und analoger Technik wurde urpsrünglich in einem aufwändigen AD-/DA-Wandlersystem computergesteuert eingesetzt. Dieses Projekt enthält Detailschaltungen die auch einzeln und in ganz anderen Zusammenhängen eingesetzt werden können: Dies sind ein einfacher Frequenz/Spannungs-Wandler ohne spezielles IC, ein Dual-Spannungs/Strom-Wandler und ein Logik-Pegelwandler.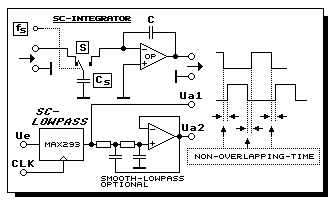
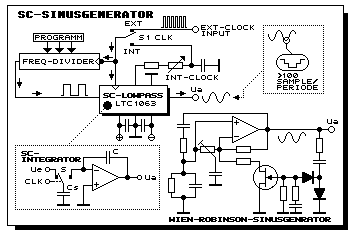 Es gibt unterschiedliche Methoden eine Sinusspannung zu erzeugen. Für hohe Frequenzen verwendet man gerne LC-Oszillatoren, während man bei niedrigeren Frequenzen RC-Oszillatoren, wie z.B. einen Phasenschieber-Oszillator, einsetzt. Besonders erwähnenswert ist der Wien-Robinson-Oszillator. Bei guter Dimensionierung erreicht man sehr niedrige Klirrfaktorwerte und eine gute Frequenzstabilität. Dies erreicht man dadurch, dass im Resonanzfall die Verstärkung die Dämpfung des frequenzselektiven Netzwerkes im Rückkopplungspfad mittels Regelung gerade so kompensiert, dass eine bestimmte Sinusspannung konstant gehalten wird. Eine derart erzeugte Sinusspannung hat wie ein LC-Oszillator etwas Natürliches an sich, weil die Sinusform durch ein Resonanzphänomen erzeugt wird.
Es gibt unterschiedliche Methoden eine Sinusspannung zu erzeugen. Für hohe Frequenzen verwendet man gerne LC-Oszillatoren, während man bei niedrigeren Frequenzen RC-Oszillatoren, wie z.B. einen Phasenschieber-Oszillator, einsetzt. Besonders erwähnenswert ist der Wien-Robinson-Oszillator. Bei guter Dimensionierung erreicht man sehr niedrige Klirrfaktorwerte und eine gute Frequenzstabilität. Dies erreicht man dadurch, dass im Resonanzfall die Verstärkung die Dämpfung des frequenzselektiven Netzwerkes im Rückkopplungspfad mittels Regelung gerade so kompensiert, dass eine bestimmte Sinusspannung konstant gehalten wird. Eine derart erzeugte Sinusspannung hat wie ein LC-Oszillator etwas Natürliches an sich, weil die Sinusform durch ein Resonanzphänomen erzeugt wird.