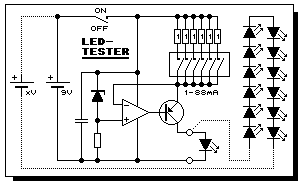Ursache zu diesem Elektronik-Minikurs sind E-Mails von ELKO-Lesern die zum Ausdruck brachten, dass sie Probleme haben mit der Anwendung von Impulsen die mit der Frequenz des 230-VAC-Netzes synchronisiert sind.
Ursache zu diesem Elektronik-Minikurs sind E-Mails von ELKO-Lesern die zum Ausdruck brachten, dass sie Probleme haben mit der Anwendung von Impulsen die mit der Frequenz des 230-VAC-Netzes synchronisiert sind.
In der Diskussion stellte sich jeweils heraus, dass es darum ging diese Impulse mit dem Sinusnulldurchgang der 230-VAC-Netzspannung zu synchronisieren. Ich habe mich mit diesem Problem etwas auseinandergesetzt und daraus entstand dieser Elektronik-Minikurs, der die Probleme thematisiert, die sich ergeben, wenn die Sinusspannung gestört ist. Es geht dabei vor allem um die niederfrequenten Rundsteuersignale, welche u.v.a. dazu dienen den Strompreis zwischen Hoch- und Niedertarif umzuschalten. Es wird eine Methode mitTiefpassfilterung gezeigt, welche eine exakte Phasenverschiebung von 180 Grad hat. Damit wird die Triggerung beim Sinusnulldurchgang und eine sehr hohe Unterdrückung der Störspannung garantiert. Wenn es allerdings darauf ankommt, dass es zwischen dem Sinusnulldurchgang auf dem 230-VAC-Netz und dem Triggerimpuls keine Laufzeitverzögerung geben darf, wird dieganze Angelegenheit problematisch und darum geht es hier zur Hauptsache. Es werden keine fertigen Rezepte geliefert. Dieser Elektronik-Minikurs regt zum Mitmachen an. Mehr dazu liest man im Kurs.
Der Inhalt an Elektronik bietet abgesehen vom Hauptthema einiges. Man lernt worauf es ankommt, wenn die Eingangsspannung bei einem Opamp oder Komparator die Grenzen der Betriebsspannung überschreitet. Der Latchup-Effekt gehört dazu. Die Eigenschaft des LinCMOS-Opamp TLC271 mit programmierbarer Leistung und Geschwindigkeit. Der Umgang mit einem Optokoppler mit geringem LED-Strom und eine bipolare Betriebsspannung von ±5 VDC und 2 mA für den Betrieb einer sehr sparsamen Schaltung direkt aus der 230-VAC-Netzspannung, bestehend aus Widerständen, Elkos und Z-Dioden mit einer Brummspannung von bloss 0.6 mV gibt es auch und eine solche Schaltung kann man noch für ganz anderes einsetzen. Ich wünsche allgemein eine spannende Lektüre.

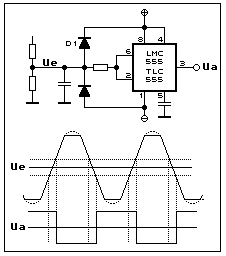 Man kann das traditionsreiche 555-Timer-IC in CMOS-Version (LMC555, TLC555) auch als präzisen Schmitt-Trigger einsetzen. Hier in einer Anwendung um ein 50-Hz-Taktsignal zu erzeugen das synchron mit der 230-VAC-Netzfrequenz arbeitet.
Man kann das traditionsreiche 555-Timer-IC in CMOS-Version (LMC555, TLC555) auch als präzisen Schmitt-Trigger einsetzen. Hier in einer Anwendung um ein 50-Hz-Taktsignal zu erzeugen das synchron mit der 230-VAC-Netzfrequenz arbeitet. Jeder Elektroniker weiss, ein Elektrolytkondensator (Elko) eignet sich nur für Gleichspannung (DC-Spannung) und nicht für Wechselspannung (AC-Spannung), ausser es ist ein spezieller bipolarer Elko…
Jeder Elektroniker weiss, ein Elektrolytkondensator (Elko) eignet sich nur für Gleichspannung (DC-Spannung) und nicht für Wechselspannung (AC-Spannung), ausser es ist ein spezieller bipolarer Elko…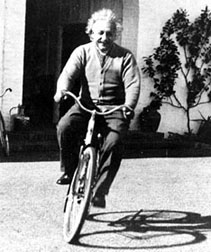 Die Relativitätstheorie von Albert Einstein feiert dieses Jahr den 100. Geburtstag. Das TECHNORAMA in Winterthur (Schweiz) präsentiert dazu eine spannende Sonderausstellung vom 25. Februar 2005 bis 12. März 2006.
Die Relativitätstheorie von Albert Einstein feiert dieses Jahr den 100. Geburtstag. Das TECHNORAMA in Winterthur (Schweiz) präsentiert dazu eine spannende Sonderausstellung vom 25. Februar 2005 bis 12. März 2006.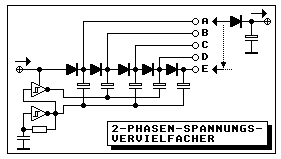 Dieser Elektronik-Minikurs zeigt wie man mittels preiswerten CMOS-ICs Spannungsverdoppler und Spannungsspiegel realisieren kann und wie mit einfacher Methode stabilisierte Spannungen erzeugt werden können.
Dieser Elektronik-Minikurs zeigt wie man mittels preiswerten CMOS-ICs Spannungsverdoppler und Spannungsspiegel realisieren kann und wie mit einfacher Methode stabilisierte Spannungen erzeugt werden können. Dass die Weltgeschichte in Blut gebadet ist, wissen alle, welche die Geschichte objektiv wahrnehmen. Dass aber die Geschichte der Elektrotechnik auch ihre dunklen Kapitel hat, von denen nur wenige Bescheid wissen, liest man u.a. im folgenen Bericht:
Dass die Weltgeschichte in Blut gebadet ist, wissen alle, welche die Geschichte objektiv wahrnehmen. Dass aber die Geschichte der Elektrotechnik auch ihre dunklen Kapitel hat, von denen nur wenige Bescheid wissen, liest man u.a. im folgenen Bericht: Dieser Elektronik-Minikurs, der seit 26.06.2002 besteht, wurde mit dem Ziel überarbeitet, dass der Inhalt verständlicher wird. Neu sind auch viele Links, die auf andere geeignete und teils ergänzende Elektronik-Minikurse hinweisen.
Dieser Elektronik-Minikurs, der seit 26.06.2002 besteht, wurde mit dem Ziel überarbeitet, dass der Inhalt verständlicher wird. Neu sind auch viele Links, die auf andere geeignete und teils ergänzende Elektronik-Minikurse hinweisen.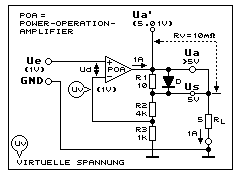 Dieser Elektronik-Minikurs über Operationsverstärker beschäftigt sich speziell mit dem Thema der virtuellen Spannung, bzw. virtuellen GND, da nicht wenige Azubis Probleme haben zu verstehen wie es dazu kommt.
Dieser Elektronik-Minikurs über Operationsverstärker beschäftigt sich speziell mit dem Thema der virtuellen Spannung, bzw. virtuellen GND, da nicht wenige Azubis Probleme haben zu verstehen wie es dazu kommt.