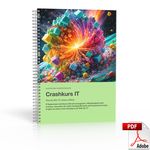Telefonie
Der Begriff Telefonie bezeichnet einen Kommunikationsdienst, bei dem Sprache zwischen zwei Teilnehmern übertragen wird. Bei mehr als zwei Teilnehmern spricht man von einer Telefonkonferenz oder kurz Telco. Die Art der Kommunikation bezeichnen wir als Telefonieren. Ein älterer Begriff ist das Fernsprechen.
Beim Telefonieren wird zwischen zwei Endpunkten eine logische Verbindung aufgebaut. Ursprünglich stand den Teilnehmern eine durchgeschaltete Leitung exklusiv zur Verfügung. Mit IP-Telefonie wird die Verbindung über ein paketvermittelndes Netz hergestellt und die Sprache in kleinen Datenpaketen hintereinander mit anderen Datenpaket transportiert.
Telefon
Als Endgerät dient typischerweise ein Telefon oder ein Smartphone. Es kann aber auch ein Desktop-PC, Notebook oder Tablet sein, in dem ein Telefon als Software realisiert ist. Man bezeichnet Software als Softphone (App). Neben der Software mit der Telefonie-Funktion muss das Endgerät über einen Lautsprecher und ein Mikrofon verfügen.
Technische Unterschiede
Von der technischen Seite her kann man Telefonieren auf drei Arten. Über einen klassischen Telefonanschluss, Telefonieren über Mobilfunk und IP-Telefonie. Genau genommen ist Voice over IP bzw. IP-Telefonie die Technik, die verwendet wird, um Sprache in paketvermittelnden Netzen zu übertragen.
- Analoge und digitale Telefonie
- ISDN-Telefonie
- IP-Telefonie
- HD-Telefonie
Analoge und digitale Telefonie
Die klassische analoge und digitale Telefonie repräsentiert zwei verschiedene Techniken für die Übertragung von Sprache in einem Telefonnetz. Im Lauf der Zeit wurde die analoge und digitale Telefonie durch Voice over IP (VoIP) abgelöst, bei der Sprachdaten mit TCP/IP übertragen werden. Die analoge Telefonie spielt nur noch als lokaler Telefonanschluss eine Rolle, um ein analoges Telefon an einem Media-Gateway anzuschließen.
ISDN-Telefonie
ISDN ist eine alte Übertragungs- und Vermittlungstechnik im ehemaligen Festnetz bzw. Telefonnetz. Mit ISDN wurden Verbindungen zwischen Teilnehmern vermittelt um Sprache und Daten zu übertragen.
ISDN spielt als Anschluss- und Übertragungstechnik keine Rolle mehr.
IP-Telefonie
IP-Telefonie ist der allgemeine Begriff für die paketvermittelte Telefonie, die auch als Voice over IP bezeichnet wird. Bei der IP-Telefonie werden die Sprachdaten mit dem Internet-Protokoll (IP) übertragen.
IP-Telefonie ist die übliche Übertragungsart, um über Netzgrenzen hinweg zu telefonieren. Nur auf der Endgeräte-Seite wird noch analoge Technik verwendet.
HD-Telefonie
Seit Anfang der Fernsprechübertragung hat sich an den technischen Rahmenbedingungen kaum etwas geändert. Auch die Tonqualität ist gleich geblieben. Audio-Signale wurden im ursprünglichen Telefonnetz nur im Frequenzbereich zwischen 300 Hz und 3.400 Hz übertragen. Damit hat man die Bandbreite für Telefonie auf 3,1 kHz beschränkt (Fernsprechkanal). Diese Beschränkung begrenzt die Sprachqualität und -verständlichkeit. Bei der Einführung von ISDN behielt man diesen technischen Parameter bei. Obwohl mit 64 kBit/s pro ISDN-Kanal deutliche größere Audio-Bandbreiten möglich waren. Man entschied sich jedoch den Codec G.711 mit maximal 3,1 kHz zu verwenden. Der Codec ist verlustfrei und erfordert wenig Rechenleistung. Man definierte G.711 fest für die Sprachübertragung.
HD-Telefonie ist ein Schlagwort hinter dem Verfahren und Maßnahmen stehen, um die Sprachqualität von Telefongesprächen zu verbessern. Mit der Möglichkeit die doppelte Audiobandbreite (7 kHz) zu nutzen erreicht man eine Sprachqualität, die an die Wiedergabe von UKW-Radio heran reicht.
Über IP-Telefonie können die beteiligten Endgeräte einen anderen Codec, als G.711 aushandelt.
Telefonanschluss in der All-IP-Welt
Alle deutschen Netzbetreiber und Provider integrieren den Telefonanschluss als Dienst oder Leistungsmerkmal in ihre Internet-Anschlüsse. Klassische Telefonanschlüsse wie den Analog- oder ISDN-Anschluss bekommt man nicht mehr.
In der All-IP-Welt erfolgt der Dienst Telefonie über Voice over IP. Hierfür gibt es verschiedene Lösungen:
- Media-Gateway für analoge oder ISDN-Endgeräte: Ein Media-Gateway dient dazu, um vorhandene ISDN-Endgeräte und analoge Telefone an einem Internet-Anschluss weiterzubetreiben. Hierzu müssen die Zugangsdaten vom SIP- bzw. VoIP-Provider im Gateway eingetragen sein. Das Media-Gateway übernimmt dann die Rolle als Vermittler zwischen der alten TK- und der neuen IP-Welt.
Media-Gateways sind in der Regel Internet-Router für den privaten Internet-Anschluss. Hier werden Internet-Routing, WLAN und Telefonie in einem Gerät vereint. - TK-Anlage bzw. VoIP-Server: Eine weitere Möglichkeit ist der Betrieb einer eigenen TK-Anlage oder eines VoIP-Servers, an der beliebige Telefone angeschlossen werden können. Hierzu müssen die Zugangsdaten vom SIP- bzw. VoIP-Provider in der TK-Anlage eingetragen sein. Die Telefone sind dabei bevorzugt VoIP-Telefone für das lokale Netzwerk mit Ethernet.
- Centrex bzw. Cloud-PBX: Im Rahmen von Software as a Service (SaaS) besteht die Möglichkeit, die TK-Anlage als TK-Leistung auszulagern. Man nennt das Centrex oder Cloud-PBX. Die TK-Anlage befindet sich dann nicht im eigenen Netzwerk, sondern in einem Rechenzentrum oder in der Cloud eines Diensteanbieters. Die VoIP-Telefone oder Media-Gateways verbinden sich dann über das Internet mit dem TK-Dienst in der Cloud.
Klassische Telefonie vs. Voice over IP
Weltweit wurden die klassischen Telefonnetze auf Zuverlässigkeit und höchste Verfügbarkeit optimiert. Die leitungsvermittelnden Systeme haben eine hohe Verbindungsqualität garantiert. Während eines Anrufs bestand eine dedizierte Verbindung zwischen den Gesprächspartnern besteht, die eine konstante Sprachqualität hatte. Irgendwann war diese Technik ausgereift.
Im Laufe der technischen Weiterentwicklung hat die Bedeutung der Übertragung von Daten zugenommen und die Protokoll-Familie TCP/IP hat alle anderen Techniken öffentlicher Vermittlungssysteme verdrängt. Technologisch war es da nur konsequent die Sprachübertragung in Form von Voice over IP in die Datennetze zu integrieren. Ein wesentlicher Vorteil von VoIP lag in seiner ressourcenschonenden Nutzung des Übertragungsmediums. Es lassen sich über ein IP-gesteuertes Netzwerk mehr Sprachverbindungen realisieren als bei der klassischen Nutzung einer Telefonleitung. Außerdem laufen Sprachverbindungen nebenher in der Summe aller Datenübertragungen mit.
Grundlagen der Fernsprechübertragung
Die Art und Weise der Übermittlung von Sprachinformationen bezeichnet man als Fernsprechübertragung. Weil der Begriff etwas angestaubt klingt, spricht man allgemein von Telefonie.
Bei der Fernsprechübertragung wird das Informationssignal, das im Ursprung von einer Schallquelle (Sprache) erzeugt wird, so umgewandelt, dass es nach der Übertragung in die ursprüngliche Schallinformation zurückgewandelt werden kann.
Übersicht: Telefonie
- Grundlagen der Fernsprechübertragung
- Grundlagen der Vermittlungstechnik
- Wahlverfahren (IWV / MFV / DEV)
- Signalisierung
- Telefonanschluss / Telefonanschlüsse
Weitere verwandte Themen:
Lernen mit Elektronik-Kompendium.de
Noch Fragen?
Bewertung und individuelles Feedback erhalten
Aussprache von englischen Fachbegriffen
Kommunikationstechnik-Fibel
Alles was du über Kommunikationstechnik wissen musst.
Die Kommunikationstechnik-Fibel ist ein Buch über die Grundlagen der Kommunikationstechnik, Internet der Dinge, Funktechnik, Mobilfunk, Breitbandtechnik und Voice over IP.
Kommunikationstechnik-Fibel
Alles was du über Kommunikationstechnik wissen musst.
Die Kommunikationstechnik-Fibel ist ein Buch über die Grundlagen der Kommunikationstechnik, Internet der Dinge, Funktechnik, Mobilfunk, Breitbandtechnik und Voice over IP.
Artikel-Sammlungen zum Thema Kommunikationstechnik
Alles was du über Kommunikationstechnik wissen solltest.