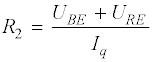Seb

21.09.2013,
16:55 |
B. Spannungsteiler: Berechnung von R_2 U_RE einbeziehen! (Elektronik) |
Im Text zur Berechnung heiße es, man können U_RE einfach weglassen was zumindest einer Simulation zufolge und logischer Schlussfolgerung ein grober Fehler ist (außer einem ist es egal das dadurch der Arbeitspunkt total verschoben ist.)
Gerade die Stromgegenkopplung sorgt doch dafür, dass U_RE nicht ganz unwichtig ist, was den Basisstrom betrifft. Lässt man in der Berechnung einfach mal eben U_RE weg, bleiben für die Strecke U_BE + U_RE nur noch 0,7 V übrig, was dafür sorgt das U_BE am ende bei ca. 0,6 V und U_RE bei 0,1 V liegen, was wiederum den Basisstrom und damit auch den Kollektorstrom beschneidet, also wie kommt man auf die Idee U_RE wäre nicht von Bedeutung?!
Auch bei der Berechnung von R_1 wird U_RE einfach außer acht gelassen.
Eigentlich: 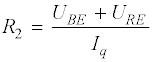
Wird zu 
Gerade das der Querstrom 10 mal großer ist sorgt doch dafür, das der Basisstrom sogut wie keinen Einfluss auf U_BE + U_RE hat. |
Kendiman
21.09.2013,
20:25
@ Seb
|
B. Spannungsteiler: Berechnung von R_2 U_RE einbeziehen! |
» Im Text zur Berechnung heiße es, man können U_RE einfach weglassen was
» zumindest einer Simulation zufolge und logischer Schlussfolgerung ein
» grober Fehler ist (außer einem ist es egal das dadurch der Arbeitspunkt
» total verschoben ist.)
» Gerade die Stromgegenkopplung sorgt doch dafür, dass U_RE nicht ganz
» unwichtig ist, was den Basisstrom betrifft. Lässt man in der Berechnung
» einfach mal eben U_RE weg, bleiben für die Strecke U_BE + U_RE nur noch 0,7
» V übrig, was dafür sorgt das U_BE am ende bei ca. 0,6 V und U_RE bei 0,1 V
» liegen, was wiederum den Basisstrom und damit auch den Kollektorstrom
» beschneidet, also wie kommt man auf die Idee U_RE wäre nicht von
» Bedeutung?!
» Auch bei der Berechnung von R_1 wird U_RE einfach außer acht gelassen.
» Eigentlich:
» 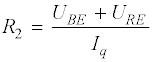
» Wird zu 
»
» Gerade das der Querstrom 10 mal großer ist sorgt doch dafür, das der
» Basisstrom sogut wie keinen Einfluss auf U_BE + U_RE hat.
Hallo,
wenn ein Emitterwiderstand RE vorhanden ist, dann muss man auch U_RE berücksichtigen.
Der RE hat entscheidenden Einfluß auf die Arbeitspunktstabilisierung des Transistors.
Wählt man zusätzlich der Querstrom des Basisspannungsteilers 10 fach größer
als den Basisstrom, so kann man die Fertigungstoleranzen des Transistors vernachlässigen.
Läßt man den Emitterwiderstand RE weg, so wird der Transistor thermisch sehr unstabil
und man muß die Transistoren einzeln ausmessen, bevor man eine Schaltung entwirft.
Der Emitterwiderstand erzeugt eine Strom-Gegenkopplung, die den
Transistor thermisch stabilisiert und die Einstellung des Arbeitspunktes erleichtert
Es gibt eine Schaltung mit Spannungs-Gegenkopplung (ohne RE), die aber nicht so effektiv ist.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass in einer Aufgabe der
Spannungsabfall U-RE vernachlässigt werden darf.
Gruß Kendiman |
Ludi
22.09.2013,
01:43
@ Kendiman
|
Quelle Elko!!! |
@ Jo : Quellenangen sind Hilfreich, meine Glaskugel ist oft in Reparatur!
@ Kendimann
Das mit dem vernachlässigen von R_E steht so im Ektronik-kompendium!!
Die Begründung auch.
Ob das stimmt, kann ich nicht beurteilen.
Grüße Ludi |
Kendiman
22.09.2013,
10:51
@ Ludi
|
Quelle Elko!!! |
» @ Jo : Quellenangen sind Hilfreich, meine Glaskugel ist oft in Reparatur!
» @ Kendimann
» Das mit dem vernachlässigen von R_E steht so im Ektronik-kompendium!!
»
» Die Begründung auch.
» Ob das stimmt, kann ich nicht beurteilen.
»
»
» Grüße Ludi
» @ Jo : Quellenangen sind Hilfreich, meine Glaskugel ist oft in Reparatur!
» @ Kendimann
» Das mit dem vernachlässigen von R_E steht so im Ektronik-kompendium!!
»
» Die Begründung auch.
» Ob das stimmt, kann ich nicht beurteilen.
»
»
» Grüße Ludi
Hallo,
ja, es wäre sehr hilfreich gewesen, wenn Seb die Quelle
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1506301.htm
gleich angegeben hätte. Dann hätte ich gleich viel besser antworten können.
Außerdem hätte ich nicht so lange suchen müssen.
Mit den gemachten Angaben zur Berechnung von R2 bin ich absolut anderer Meinung.
Die originale Formel ist o.k.
Die vereinfachte Formel bringt so viel Abweichung, dass die Schaltung kaum
funktionieren kann
Beispiel: IB = 0,5 mA Iq = 10 * IB = 5 mA ( akzeptabel ), UBE = 0,6 V (Silizium)
Ub = 12 V , URE = 1,2 V ( 10 % der Betriebsspannung für URE sind ein
vertretbarer Kompromiss.
Je geringer die Spannung am Emitterwiderstand RE umso schlechter ist die
thermische Arbeitspunktstabilisation.
Je größer die Spannung an RE umso weniger hat der Transistor zur Aussteuerung.
Bei 10 % URE vom Ub ergibt sich folgendes für den Arbeitspunk A
Ub = 12 V, URC = 5,4 V , UCE = 5,4 V URE = 1,2 V
R2 = (UBE + URE)/ Iq = ( 0,6 V + 1,2 V ) / 5 mA = 360 Ohm (URE berücksichtigt)
R2 = URE / Iq = 0,6 V / 5 mA = 120 Ohm (vereinfachte Formel)
Der Unterschied ist einfach zu groß !
Gruß Kendiman
 |
BernhardB
Berlin,
22.09.2013,
14:47
@ Ludi
|
Quelle Elko!!! |
» Die Begründung auch.
» Ob das stimmt, kann ich nicht beurteilen.
»
Hi,
die Begründung führt zu einem Trugschluss für die Berechnung und ist selbst auch ein Trugschluss.
Sie geht davon aus, dass der Emitterwiderstand um den Faktor (B+1) vergrößert im Basiskreis "auftauche".
Richtig ist, dass durch Re eine Erhöhung des Eingangswiderstandes der eigentlichen Transistorstufe (ohne den Einfluss der wechselstrommäßig parallel liegenden Widerstände R1 und R2) hervorgerufen wird.
Dieser erhöhte Eingangswiderstand tritt zwischen Basis und GND auf. Er äußert sich so, dass eine kleine Erhöhung des Basisstroms dIb (ganz egal, durch was genau hervorgerufen) zusätzlich zur Änderung von Ube eine Spannungsänderung von dIb*(B+1)*Re an der Basis verursacht. Also: gleiche BasisSTROMänderung, aber größere SPANNUNGSänderung- das entspricht einem größeren WIDERSTAND.
Dies betrifft sowohl den statisch fließenden Basisstrom im Arbeitspunkt, als auch Basisstromänderungen, die durch ein anliegendes veränderliches Signal hervorgerufen werden.
Beim Einschalten der Stufe ändert sich der Basisstrom von null auf den im Arbeitspunkt vorgegebenen Basisstrom. Dem entspricht eine vorgegebene Spannung am Emitter und folglich auch eine gegenüber dem Emitter um Ube höhere Spannung an der Basis.
R2 muss nun einfach so bemessen sein, dass sich beim gewählten Iq genau diese Spannung einstellt. Genau das drückt die Originalformel aus.
Das hat nichts damit zu tun, dass tatsächlich an der Basis ein Eingangswiderstand in Erscheinung tritt, der etwa (B+1)*Re beträgt.
Überbrückt man z.B. Re mit einem genügend großen Kondensator, hebt man die Änderung des Eingangswiderstandes für die Signalfrequenzen auf, der Eingangswiderstand verringert sich, und die Verstärkung steigt durch Wegfall der Gegenkopplung, die Re hervorruft.
Für die Gleichspannungsverhältnisse (und damit auch die Widerstände Re, R1 und R2) bleibt dagegen alles beim Alten.
Gruß
Bernhard |
Patrick Schnabel

24.09.2013,
09:06
@ Seb
|
B. Spannungsteiler: Berechnung von R_2 U_RE einbeziehen! |
» Im Text zur Berechnung heiße es, man können U_RE einfach weglassen was
» zumindest einer Simulation zufolge und logischer Schlussfolgerung ein
» grober Fehler ist (außer einem ist es egal das dadurch der Arbeitspunkt
» total verschoben ist.)
» Gerade die Stromgegenkopplung sorgt doch dafür, dass U_RE nicht ganz
» unwichtig ist, was den Basisstrom betrifft. Lässt man in der Berechnung
» einfach mal eben U_RE weg, bleiben für die Strecke U_BE + U_RE nur noch 0,7
» V übrig, was dafür sorgt das U_BE am ende bei ca. 0,6 V und U_RE bei 0,1 V
» liegen, was wiederum den Basisstrom und damit auch den Kollektorstrom
» beschneidet, also wie kommt man auf die Idee U_RE wäre nicht von
» Bedeutung?!
» Auch bei der Berechnung von R_1 wird U_RE einfach außer acht gelassen.
» Eigentlich:
» 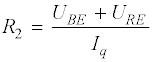
» Wird zu 
»
» Gerade das der Querstrom 10 mal großer ist sorgt doch dafür, das der
» Basisstrom sogut wie keinen Einfluss auf U_BE + U_RE hat.
Danke. Korrigiert. --
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |

 Thread-Ansicht
Thread-Ansicht